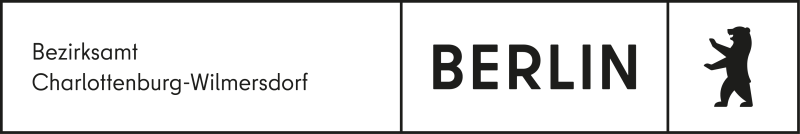bq. Offenbar hat der Talmud am Ende recht behalten: „Eine Gemeinschaft kann nicht sterben!“ Mehr als 70 Jahre nach der Shoah gibt es in Berlin wieder eine große jüdische Gemeinde, etwa 30.000 Israelis leben in Berlin und regelmäßig wird Berlin unter jungen Israelis zu der beliebtesten touristischen Destination gewählt. Politisch und staatlich ist die Erinnerung an die Shoah fest im Bewusstsein der Hauptstadt verankert; es gibt ein Holocaust-Denkmal und der Geschichtsunterricht über diese Zeit ist an allen Schulen Pflicht. Insofern wurde alles getan, damit sich auch nachfolgende Generationen dieses unvergleichbare und unbeschreibbare Verbrechen vergegenwärtigen. Gerade weil man die gesamte Geschichte des Dritten Reichs im Grunde als einen Krieg gegen die Erinnerung verstehen kann.
Aber die staatliche Erinnerungskultur mit ihrer offiziellen Erinnerungsdaten und Orten bleibt oft abstrakt und vom Alltag der heute lebenden Deutschen weit entfernt. Es ist heute eben nur noch schwer vorstellbar, wie Täter und Opfer in der Zeit lebten und handelten. Sebastian Haffner, selbst ein Betroffener und Emigrant, erklärt uns diese „Spirale des Mitmachens“: „Alle Deutschen haben am Anfang nicht mehr gewollt als jeder Mensch wollen mag; in einer allgemeinen Panik ihr kleines Privatidyll retten, ihre Familie, ihr Gärtlein oder ihre Bücher. Man habe ihnen einen Preis gemacht, der sukzessive gesteigert wurde. Dafür, daß die weiterhin ruhig leben durften, haben sie zuerst ihre politische Freiheit aufgeben müssen, dann ihre jüdischen Freunde, dann ihre persönliche Würde, schliesslich immer mehr von ihrem Gewissen, ihrem Ich, ihrer moralischen Existenz.“ Am Ende wollten die Deutschen nicht mehr sehen, wie, „während auf dem Kurfürstendamm ordensgeschmückte
Offiziere spazierten, in den Seitenstrassen die gebückten, bleichen Juden schlichen“, sie hörten nicht, wie am Wochenende die Lastwagen des SD die Seitenstraßen blockierten, wie „ihre Nachbarn aus den Wohnungen geprügelt wurden“ und „wie ein Stück Vieh
auf die Lastwagen geschmissen wurden“. Wie der Herr Iggen in Bertolt Brechts „Maßnahmen gegen die Gewalt“ sagte die überwältigende Mehrheit der Deutschen erst „Nein“, nachdem die Gewalt(herrschaft) vorüber war. Die Nöte und Ängste der Opfer sind noch weit schwieriger zu verstehen; die subtile, fortschreitende Entrechtung und Entmenschlichung bis zu dem Zeitpunkt hin, wo ihnen buchstäblich nichts mehr blieb, als auf den Abtransport ins Vernichtungslager zu warten.
Am besten können wir diese Grausamkeiten verstehen, wenn wir uns die Schicksale einzelner Menschen erzählen (lassen) und damit vergegenwärtigen. Inge Deutschkrons bewegende Autobiographie ist ein wunderbares Beispiel dafür.
Doch auch die Stolperstein-Initiative Gunter Demnigs, die 1992 als ein Einmann-Projekt begann, ist nun ganz bestimmt ein wichtiger Beitrag dazu, den einzelnen Opfern ihre Namen zurückzugeben, sie aus der Anonymität der Geschichte zurückzuholen und schließlich uns die Namen von ehemaligen Nachbarn und Mitbürgern zu vergegenwärtigen. Es zeigt sich mit der Steinlegung, dass Namen eben nicht nur „Schall und Rauch“ sind; die Begehung der Stolpersteine bietet heute für Nachfahren von Opfern und Tätern gleichermaßen Gelegenheit dazu, zu erkennen, wie es diesen ergangen ist bzw. was diese begangen haben. Es ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass im Moment der Konfrontation mit den Namen auf den gold-glänzenden Steinen ein Nachdenken einsetzt: heutige Bewohner überlegen, was sie wohl in diesen dunklen Zeiten gemacht hätten,
israelische Besucher erklären ihren Kindern, was mit den Menschen hinter den Namen geschehen war, Passanten kommen mit Bewohnern ins Gespräch und so weiter. Die abstrakte Nebelwand der Geschichte wird im Augenblick des Stolperns zum anrührenden Moment, zum Innehalten und Nachdenken.
Zu Beginn der Recherche-Arbeit hätte ich nie für möglich gehalten, dass (mehr als) 15 Menschen aus diesem Haus verschleppt und ermordet wurden und das Schicksal von fünf weiteren Bewohnern bis heute ungeklärt bleibt. Im Mikrokosmos unseres Hauses spiegelt sich das ganze Spektrum der national-sozialistischen Vernichtungspolitik wider; Kinder und Greise wurden abgeholt und
ermordet, versteckte Juden von ihren deutschen Mitbewohnern verraten, der Abtransport von Gaffern beobachtet (das ließ sich auch damals bei den örtlichen Gegebenheiten gar nicht vermeiden), der Hauswart war pflichtbewusst immer zur Stelle, das Eigentum schnell von Profiteuren übernommen und die damalige Eigentümerin bereicherte sich an dem Verbliebenen. Die Xantener Straße war auch in den dreißiger und vierziger Jahren eine bevorzugte Wohnlage mit einem hohen jüdischen Bewohneranteil. An einem Ende der Straße wuchsen die Jungen Heinz Berggruen und Michael Blumenthal auf. Am anderen Ende der Straße lebte und wirkte Stella Goldschlag, eine Jüdin, die den Pakt mit dem Teufel einging und bis zu 900 untergetauchte Juden aufspürte und an die Nazis auslieferte.
Indem wir heute die Steine für 15 Opfer setzen, machen wir aus Zahlen wieder Namen, aus Namen wieder Menschen. Zwischen Rosh ha-Shanah und Yom Kippur beten fromme Juden „schreibe uns ein in das Buch des Lebens“. Wir wissen nicht, wie viele unserer Opfer religiös waren oder ob sie überhaupt in einer Verbindung zum Judentum standen, die über ihre Markierung von Seiten der Täter hinausging, aber wir können heute ihre Namen in das Buch dieses Hauses einschreiben.
Wir setzen heute die Steine für: Georg Joseph, 1890 geboren und Inhaber des Charlottenburger Bekleidungshauses. Er lebte mit seiner Schwester Paula Segall und deren Tochter Marion in unserem Haus, bis er am 31. Juli 1942 die Wohnung räumen mußte. Georg Joseph, seine Schwester und seine Nichte wurden dann von Frau Emma Kleinert auf dem Dachboden versteckt, verraten und anschließend in das Ghetto Riga deportiert. Abraham Apelbaum war Rentier und Hausbesitzer. Am 5. März 1943 wurde er nach Theresienstadt deportiert und am 16. Mai 1944 in Auschwitz ermordet. Nanni Grünthal war bereits verwitwet, als sie am 3. August 1943 abgeholt wurde. Sie starb am 16. Mai 1944 in Auschwitz. Leonhard Reiss, geboren 1889 in Berlin, lebte mit seiner Frau Martha in der Xantener Straße. Er war Bankbeamter. Sie wurden am 17. November 1943 nach Auschwitz deportiert, wo beide
ermordet wurden. Margarete Regensburger war die Witwe des Justizrats Regensburger; sie wurde am 29. Oktober 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort am 28. Februar 1944. Walter Loepert lebte mit seiner Frau Käthe und den Töchtern Eva (geb. 1925) und Annemarie (geb. 1929) im 2. Stock des Hinterhauses. Er war von Beruf Handelsvertreter. Die Loepert-Familie wurde am 28. März 1943 in das Ghetto Piaski deportiert und dort ermordet.
Arthur Abraham Jachmann führte mit seiner Frau Hertha ein Wäschegeschäft in der Neuen Friedrich Str. 38. Das Ehepaar Jachmann wohnte auf der Westseite, 1 Treppe. Hertha Jachmann beging am 1. Juni 1942 Selbstmord, ihr Mann wurde am 4. August 1942 deportiert und starb am 5. Mai 1943.
Clara Hammel wohnte zur Untermiete bei Frau Regensburger. Sie wurde am 25. September 1942 deportiert und starb am 7. Oktober 1942.
Wir erinnern auch an die Opfer, deren Schicksal ungeklärt bleibt: Rosa Gotha, Elly Singer, Ernst Bobrowski, Marga Mindla Syna, Emma Pintus und Helene Jacoby. Unvergessen bleibt auch Emma Kleinert, eine Schneiderin aus der Sybelstrasse 38, die Georg Joseph, Paula und Marion Segall versteckte und damit bewies, dass man auch in diesen unmenschlichen Zeiten Mensch bleiben kann.
Die gold-glänzenden Steine für die jüdischen Opfer dieses Hauses liegen nun Aug-in-Aug zu den Namen der heutigen Bewohner auf dem gold-glänzenden Klingelbrett und erinnern uns daran, was in widrigen Zeiten aus einem „ehrenwerten Haus“ werden kann.
Martin Ritter (Berlin, Xantener Straße 7)