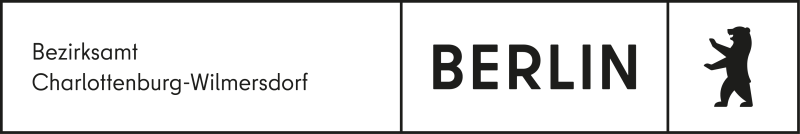Paul Alexander wurde am 09. Dezember 1870 in Tirschtiegel, Kreis Meseritz in Posen (heute Trzciel) geboren, als Sohn von Salomon Alexander und seiner Frau Rebecca geb. Pinner. Salomon Alexander war Religionslehrer (Melamed) und Schächter. 1870 lebten in Tirschtiegel rund 200 Juden, es hatte aber schon eine Abwanderung in größere Städte begonnen. Auch Salomon Alexander zog nach Leipzig, noch bevor Paul 10 Jahre alt wurde. Paul hatte drei Brüder, Georg, Edgar und Alexander, und zwei Schwestern, Gertrude und Hylia. Die Kinder wuchsen in einer religiösen und bildungsbewussten Familie auf. Gertrude verstarb bereits im Kindesalter.
In Leipzig machte Paul nach dem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung als Pharmazie–Techniker. Hierin erhielt er so gute Zeugnisse, dass er ohne Abitur zum Chemiestudium zugelassen wurde. Wahrscheinlich wurde sein Studium von seinem in USA lebenden Onkel Moritz Pinner, einem Bruder seiner Mutter, finanziert. 1897 promovierte Paul an der Univesität Leipzig mit der Arbeit „Über die Einwirkung von o-Nitrobenzylchlorid und Matriummalonsaeureaethylester“.
Wahrscheinlich kurz danach übersiedelte er nach Berlin, wo sein Onkel Adolf Pinner als anerkannter Chemieprofessor an der Berliner Universität ihm sicher beruflich behilflich war und dessen Haus er auch vor seiner Promotion frequentierte. An Pfingsten 1886 „fand“ Paul – nach eigenen Worten – „die Gefährtin, die meinem Leben Richtung und Inhalt gab“. Es war seine Cousine Elfriede, eine Tochter Adolf Pinners. Möglicherweise war dies das Datum der Verlobung und sie heirateten erst ein paar Jahre später.
Elfriede Pauline Pinner, genannt Frieda, war am 27. November 1875 in Berlin geboren worden als erstes Kind von Adolf Pinner und seiner Frau Anna geb. Moritz. Sie bekam noch drei Geschwister: 1877 Katharina (Käthe), 1881 Ernst Ludwig und 1888 August Wilhelm. Ernst Ludwig, der wie sein Vater Chemie studierte, verunglückte 1911 tödlich in den Dolomiten. Vier Jahre später fiel August Wilhelm im Ersten Weltkrieg.
Frieda wuchs in einer wohlhabenden assimilierten bürgerlich-liberalen Familie auf. Ihr Vater war nicht nur bekannter Wissenschaftler sondern auch geachtetes Mitglied der Jüdischen Gemeinde und Vorstand des 1893 gegründeten „Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“. Ihre Kindheit und Jugend verlebte Frieda auf dem Gelände der Tierärztlichen Schule bei der Charité. Adolf Pinner, der dort lehrte, hatte eine Wohnung in der Philippstraße 13 bekommen. Heute noch steht unter dieser Adresse das älteste akademische Lehrgebäude Deutschlands, 1789/90 von Carl Gotthard Langhans erbaut, das „Tieranatomische Theater“, in dem heutzutage wissenschaftliche Ausstellungen stattfinden. Als der erste Bruder Friedas zur Welt kam, änderte sich die Adresse in Luisenstraße 56, wobei es sich sowohl um das gleiche Gebäude handeln kann wie um eine andere, vermutlich größere Wohnung im gleichen Komplex. Dort wohnte Frieda bis zu ihrer Heirat mit Paul Alexander um die
Jahrhundertwende. Im Berliner Adressbuch ist Dr. phil. Paul Alexander erst 1903 verzeichnet, in der Friedbergstraße 23, von 1905 bis 1910 in der Holtzendorffstraße 18.
1910 war Paul für das Chemielabor Max Fränkel & Runge in Spandau tätig. Möglich, dass er schon länger für sie arbeitete, die Firma war 1901 von der Großen Hamburger Straße in Berlin nach Spandau gezogen. Ursprünglich hatte sie Tinten, Tuschen, Stempelfarben, Klebstoffe u. ä. hergestellt, später war sie offenbar hauptsächlich in der Herstellung von Kautschukderivaten tätig, denn dies wurde ein Spezialgebiet von Paul Alexander. Paul hatte sich in der Firma eine wichtige Stellung erworben, er wurde zu einem international anerkannten Experten v.a. in der Kautschukregeneration, heute würde man Kautschuk-Recycling sagen. Kautschuk war seinerzeit ein wichtiger Rohstoff und die Wiederverarbeitung von Gummiabfall ein volkswirtschaftlich bedeutsames Gebiet. 1916 wurde die Firma in die Runge-Werke A.G. umgewandelt, Paul war der Vorstandsvorsitzende und Fabrikleiter. Zahlreiche Publikationen auf seinem Spezialgebiet und mehrere Patente im In- und Ausland dokumentieren Paul
Alexanders internationale Bedeutung.
1916 wohnten Frieda und Paul bereits seit 7 Jahren in der Dernburgstraße 4 und hatten 6 Kinder. Ruth, die Jüngste, war im August 1915 zur Welt gekommen, zwei Jahre zuvor Brigitte, 1909 Elisabeth, 1906 Gertrude und 1903 Marianne. Friedrich Ludwig, der einzige Sohn und erstes Kind, wurde am 7. November 1902 geboren. 1917 kaufte die Familie ein Grundstück an der Heerstraße in der Insterburgallee, um dort eine Villa bauen zu lassen. Zunächst zogen sie aber in eine wohl größere Wohnung am Kaiserdamm 51. Der Bau der Villa wurde nicht gleich in Angriff genommen, noch 1923 gilt die Insterburgallee im Adressbuch als „unbebaut“. Erst 1923/24 ließen Alexanders vom renommierten Architekten Hermann Muthesius die Villa mit Terrasse errichten. Der Umzug in die Insterburgallee 21 erfolgte 1924. Grundstück und Villa waren mit der Mitgift von Frieda finanziert worden, denn, obwohl Paul durch seine Runge-Werke zu Wohlstand kam, investierte er sein Vermögen immer wieder in die Firma.
Diese, die Firma, bekam Mitte der 20er Jahre Schwierigkeiten. Die Rohstoffpreise für Kautschuk auf dem Weltmarkt sanken, Plastik wurde zur wachsenden Konkurrenz, ein Gummi-Recycling war nicht mehr so lohnend. Hinzu kam die Inflation. Trotz aller Bemühungen Pauls musste die Firma 1928 Insolvenz anmelden. Er beantragte ein Vergleichsverfahren und kämpfte über Jahre für den Erhalt der Firma, sein Lebenswerk. Sein ganzes Vermögen sowie der Erlös vom Verkauf eines Teils des Grundstückes in der Insterburgallee und ein Darlehen von über 10000 RM von seinem Bruder Edgar gingen dabei verloren. Denn 1933 galt der Vergleich als gescheitert, 1935 wurde die Firma gelöscht. Im Rahmen von Hitlers Autarkiepolitik gewann Gummirecycling zwar wieder an Bedeutung, Paul Alexander aber konnte als Jude an dem neuen Aufschwung nicht mehr teilhaben.
Juden sahen sich inzwischen unter Hitler zahlreichen Diskriminierungen und Einschränkungen im täglichen und im Berufsleben ausgesetzt. 1937 war Paul Alexander gezwungen, das Haus in der Insterburgallee zu verkaufen und mit der noch bei den Eltern lebenden Tochter Elisabeth in die Mommsenstraße 47 zu ziehen. Die anderen Kinder, außer Ruth, waren längst verheiratet und schon nach Palästina und Südafrika emigriert. Ruth arbeitete seit 1934 in der jüdischen Jugendhilfe in München und Dinslaken. Anfang 1938 hielt sie sich wahrscheinlich bei den Eltern in der Mommsenstraße auf, wanderte aber auch im Juli 1938 nach Palästina aus. Für Elisabeth, die seit Geburt herzkrank war und außerdem an Depressionen litt, konnte kein Visum beschafft werden. Dies war auch der Grund, warum Paul und Frieda, trotz dem Drängen ihrer Kinder, ihre eigene Auswanderung nicht betrieben, sie wollten auf keinen Fall Elisabeth, Bethchen genannt, zurücklassen.
Im November 1936 starb Friedas Mutter Anna – sie war schon seit 1909 Witwe – und Friedas ebenfalls verwitwete Schwester Käthe, verheiratete Wolff, die mit der Mutter gelebt hatte, zog zu Frieda in die Mommsenstraße. Paul arbeitete weiter an seinem Spezialthema Kautschuk, seine Artikel mussten aber ohne Namensnennung veröffentlicht werden oder in ausländischen Zeitschriften erscheinen. Er konnte sogar 1937 einen Fachkongress in Paris und 1938 die Gummitagung in London besuchen.
Nach den Pogromen vom 9./10. November 1938 verschlechterte sich das Leben von Juden drastisch. Eine Flut von Verordnungen, Verboten und Zwangsmaßnahmen führte zur weiterer Verarmung, Isolierung und Ausschluss aus der Gesellschaft. Wer noch nicht geflohen war, sollte dazu gezwungen werden. Andererseits waren die Hürden dazu immer höher. Mit Kriegsbeginn wurde die Emigration praktisch unmöglich. Noch im Februar 1939 gelang es Käthe nach Panama auszureisen, was einen weiteren schmerzlichen Verlust für Frieda, Paul und Elisabeth bedeutete.
Danach wurde es fortwährend schlimmer. Ab September 1941 mussten Juden den Stern tragen, im Januar 1942 wurde Elisabeth zur Zwangsarbeit – von der sie bis dahin befreit gewesen war – herangezogen und verfiel wieder in eine tiefe Krise. In ihrer Wohnung mussten die Alexanders eng zusammenrücken, in vier der Zimmer hatten sie zwangseingewiesene Juden unterzubringen. Der für Paul und Frieda sehr wichtige Briefaustausch mit den Kindern im Ausland war mit Kriegsbeginn abgebrochen. Mit Datum 25. Mai 1942 verfasste Paul einen acht eng beschriebene Seiten langen Brief an seine Kinder, den er in verschiedenen Durchschlägen an Freunde zur Verwahrung gab. Von einem von ihnen erhielten ihn die Kinder – erst nach dem Krieg. In dem Brief zieht Paul ausführlich Bilanz über seine Lebensarbeit, die er als Dienst an der Allgemeinheit verstand, da er dem Staat viele Ressourcen gespart und Devisen eingebracht habe. Einen Monat später schrieb er noch einen bitteren dreiseitigen
Nachtrag: Am 17. Juni waren ihm per Post von der Jüdischen Kultusvereinigung die Formulare zur Vermögenserklärung zugeschickt worden, der Vorbote der Deportation. Es sei ihnen verkündet worden, dass Paul und Frieda zum „Abtransport“ nach Theresienstadt „ausersehen“ seien. Elisabeth habe beantragt, sie begleiten zu dürfen, sollte dies ohne Erfolg bleiben, fürchtete Paul, sie würde sich umbringen.
Es blieb offenbar ohne Erfolg, und die düstere Vorahnung Pauls erfüllte sich. Am 4. August 1942 wurden Paul und Frieda Alexander mit 98 weiteren Opfern in zwei verplombten Waggons, die an den fahrplanmäßigen 6.07 Uhr Zug nach Prag angehängt wurden, nach Theresienstadt deportiert. Einen Tag zuvor, am 3. August, stürzte sich Elisabeth aus dem Fenster im 3. Stock in der Mommsenstraße. Es ist zweifelhaft, ob ihre Eltern das noch erfuhren, denn sie waren zuvor in die Sammelstelle in der Großen Hamburger Straße 26 transportiert worden – Elisabeth war allein zurückgeblieben.
Theresienstadt galt zwar als Vorzeige-Ghetto, in dem die Juden angeblich ein „angenehmes Leben“ mit eigenen Kultureinrichtungen usw. führen könnten – folgte man der entsprechenden Propaganda. Aber in Wirklichkeit war es nur eine Durchgangsstation, die in den systematisch herbeigeführten Tod führte. Wer dort nicht an Krankheit und Entkräftung ob der miserablen Lebensumstände starb, wurde nach „Osten“ weiterdeportiert. Paul Alexander überlebte die Ankunft in Theresienstadt lediglich einen Monat. Am 5. September 1942 erlag er um 4 Uhr früh den dortigen Daseinsbedingungen, offiziell einem akuten Darmkatarrh, sicherlich Folge der katastrophalen hygienischen Zustände. Drei Wochen später, am 21. September 1942 (zwei Monate vor ihrem 67. Geburtstag) wurde Elfriede Alexander weiter nach Treblinka verschleppt und dort ermordet. Paul hatte seinen 72. Geburtstag nicht mehr erreicht.
Paul und Frieda Alexanders Hab und Gut „verfiel“ an das Deutsche Reich: nicht nur noch vorhandenes Vermögen wurde enteignet, die gediegene Wohnungseinrichtung, von Paul Alexander mit bitterer Ironie minutiös aufgeführt (z.B.: „Besteckkasten 0 Teile“ – wie alle Juden hatten Alexanders Schmuck und Silber 1939 abgeben müssen) wurde auf 3470 RM geschätzt. Paul war sich bewusst, dass der „gesamte Besitz für die Betroffenen unwiederbringlich verloren“ sei. Mit der von Paul besonders hervorgehobenen Fachbibliothek von 2200 Schriften, deren Wert er auf 10000 RM schätzte, konnten die den Nachlass ersteigernde Trödler vermutlich wenig anfangen.
Pauls Bruder Edgar, der Arzt in Leipzig war, später aber auch nach Berlin zog, war schon am 20. Juli 1942 ebenfalls nach Theresienstadt deportiert worden. Wahrscheinlich konnten ihn Paul und Elfriede dort auch treffen. Edgar starb dort am 1. Dezember 1942, laut offizieller „Todesfallanzeige“ an einer Gehirnblutung. Auch Pauls Bruder Georg und dessen Sohn Fritz wurden Opfer des Holocaust. Wie Georg umkam, ist nicht eindeutig zu ermitteln. Fritz Alexander wurde am 26. September 1942 nach Raasiku in Estland verschleppt, wo die nicht gleich Erschossenen zur Zwangsarbeit in der Ölschiefergewinnung eingesetzt wurden. Da Fritz Alexander nicht im Gedenkbuch des Bundesarchivs aufgeführt ist, könnte er überlebt haben, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist.
Quellen:
Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Landesarchiv Berlin; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Akten der Oberfinanzdirektion; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005; Karola Nick, Kommentare zu den „Alexander-Briefen“, Jüdisches Museum Frankfurt/M; Todesfallanzeige Paul Alexander: https://www.holocaust.cz/de/datenbank-der-digitalisierten-dokumenten/dokument/81683-alexander-paul-todesfallanzeige-ghetto-theresienstadt
Recherchen/Text: Micaela Haas