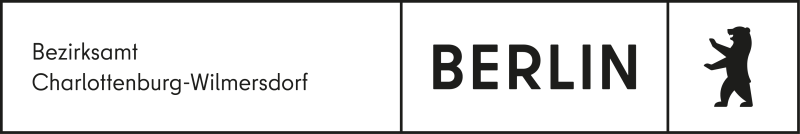HIER WOHNTE
WALTER WEILE
JG. 1990
DEPORTIERT 2.3.1943
AUSCHWITZ
ERMORDET
Walter Weile wurde am 9. Mai 1900 als jüngstes Kind von Iwan Isaac Weile und Bertha geb. Benzion in Hamburg-Altona geboren. Er hatte vier Brüder und eine Schwester. Walters Vater war Kaufmann und handelte mit Rohtabak und Zigarren. Um 1914 zog er mit seiner Familie nach Berlin, wo er sich als Handelsvertreter für Zigarren in Neukölln niederließ. 1916 starb Walters 18-jähriger Bruder. 1918 zog Iwan Weile nach Schöneberg um. Walter wohnte zu dem Zeitpunkt wohl noch bei seinen Eltern. Er machte eine kaufmännische Ausbildung in der Textilbranche. Vielleicht lernte er darüber den Vertreter für Tuchfabriken Eugen Herzberg und dessen Tochter Ilse kennen. Ilse war fünf Jahre älter als Walter, sie war am 13. März 1895 geboren. Sie heirateten und bezogen eine 4-Zimmer-Wohnung in Friedenau, Rheinstraße 30. Auch mindestens zwei von Walters Brüdern, Julius und Leonhard, ließen sich zeitweise in Berlin nieder.
Ilses Vater, Eugen Herzberg, stammte aus Mehlsack in Ostpreußen (heute Pieniężno in Polen). Er muss schon in jungen Jahren nach Berlin gekommen sein; als hier seine Tochter Ilse auf die Welt kam, war er erst 25 Jahre alt. Ilses Mutter, Irma geb. Jaffé, war nur zwei Jahre nach Ilses Geburt gestorben, der Vater hatte erneut geheiratet und Ilse bekam 1901 einen Halbbruder, Gerhard, der später, 1924, in das Geschäft des Vaters mit einstieg. Die Textilvertretung betrieb Eugen Herzberg seit mindestens 1895, 1904 ließ er sie in das Handelsregister eintragen. Laut seinem Sohn Gerhard arbeiteten sie nur für „allerbeste deutsche und ausländische Tuchfabriken“. Der Sitz der Firma war zunächst am Hausvogteiplatz, später in der Mohrenstraße 40, die Wohnadresse der Familie wechselte mehrmals, sie lag erst im Hansaviertel, nach der Jahrhundertwende in der Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Karl-Liebknecht-Straße). Hier dürfte Ilse den größten Teil ihrer Kindheit verbracht haben.
Wann Walter und Ilse heirateten ist nicht dokumentiert, im Berliner Adressbuch ist Walter erstmals 1930 in der Rheinstraße 30 vermerkt. Die Ehe blieb kinderlos. Ilse hatte wahrscheinlich Musik studiert und gab Klavierunterricht.
In den Jahren nach Hitlers Machtübernahme verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen für jüdische Kaufleute zusehends. Boykott und immer mehr Diskriminierungsmaßnahmen, bis hin zum gänzlichen Verbot selbstständiger Arbeit mit der „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ vom 12. November 1938 – unmittelbar nach den Pogromen vom 9./10. November – führten zur völligen Verdrängung Walter Weiles aus dem Berufsleben.
Hinzu kamen noch die vielen antisemitischen Maßnahmen, die den Alltag einschränkten und erschwerten. Sie häuften sich noch nachdrücklich nach den November-Pogromen. Juden durften nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen, nicht in Theater, Konzerte, Kinos usw., zu bestimmten Zeiten durften sie gar nicht mehr auf die Straße, durften nur von 4 bis 5 Uhr nachmittags einkaufen. Alle Wertgegenstände mussten sie abliefern, Rundfunkgeräte wurden beschlagnahmt, Telefonanschlüsse gekündigt, ihre Konten wurde zu „Sicherheitskonten“ erklärt, von denen sie nur durch „Sicherungsanordnung“ festgelegte Beträge für ein Existenzminimum abheben durften. Walter und Ilse mussten bald ihre Wohnung in Friedenau aufgeben. Zwar wohnten sie noch dort, als sich Ilses Halbbruder Gerhard Herzberg im November 1938 von ihnen verabschiedete. Er emigrierte nach London, nachdem auch seine und seines Vaters Firma seit längerem keine Geschäfte mehr tätigen konnte. Aber bei der
Volkszählung im Mai 1939 wohnten Ilse und Walter bereits zur Untermiete in der Wielandstraße 17. Sie wurden in den sog. „Ergänzungskarten“ für Juden erfasst. In diesen Ergänzungskarten wurde registriert, wer wie viele jüdische Großeltern hatte. Obwohl diese Daten offiziell dem Statistikgeheimnis unterlagen, kann man sich denken, dass diese Kartei für die Judenverfolgung missbraucht wurde, z.B. bei der Zwangsverpflichtung zur Arbeit.
Waren zunächst (ab 1936) „nur“ arbeitslose unterstützungsbedürftige Juden zur Arbeit zwangsverpflichtet worden, so setzte man ab Kriegsbeginn immer mehr für arbeitsfähig befundene Juden in der Rüstungsindustrie zwangsweise ein. 1941 wurden mit der Einführung des „Beschäftigungsverhältnisses besonderer Art“ die bereits praktizierten Verhältnisse zementiert: niedrige Löhne, kein Arbeitsschutz, keine Sozialversicherung. Auch Walter und Ilse wurden zwangsverpflichtet, Walter bei dem Kabelwerk Gartenfeld von Siemens, Ilse bei Osram in der Warschauer Straße. 1941 waren sie auch gezwungen worden, nochmal umzuziehen, in die Nürnberger Straße 66, bei David Coper. Dort bewohnten sie zusammen ein Zimmer.
In der Rüstungsindustrie arbeitende Juden wurden zunächst von Deportation zurückgestellt. Im Februar 1943 jedoch beschloss das Reichsicherheitshauptamt, diese Zwangsarbeiter nach Auschwitz zu deportieren um sie dort angeblich in den Buna-Werken einzusetzen. In einer Blitzaktion wurden Ende Februar/Anfang März 1943 Tausende von Arbeitern nicht nur in Berlin direkt am Arbeitsplatz festgenommen und in z.T. improvisierte Sammellager gebracht. Auch Walter und Ilse wurden Opfer dieser sogenannten Fabrik-Aktion. Sie wurden wahrscheinlich an kurz aufeinander folgenden Tagen von der Arbeit weg verhaftet, aber in das gleiche für diese Aktion eigens eingerichtete Lager in der Reithalle der Rathenower Kaserne in Moabit gebracht, so dass sie sich vielleicht noch einmal sehen konnten. Ilse unterschrieb ihre „Vermögenserklärung“ am 27. Februar, Walter seine am 1. März. An diesem Tag wurde Ilse nach Auschwitz deportiert, Walter mit dem nächsten Reichsbahn-Zug am 2. März 1943. Ilses
und Walters spärliche Habe war in der Nürnberger Straße geblieben, wo sie zuletzt allein gelebt hatten: David Coper war mit seiner Frau Lotte, geb. Ebenstein und der Tochter Margot bereits am 16. Oktober 1942 nach Riga deportiert worden. Copers „Sachen“ wurden mit denen von Weiles – inklusive 150 kg Kohlen und 15 kg Kartoffeln, die Ilse auf dem Balkon gelagert hatte – an den Händler Fenske, Schreinerstraße 12, für 216 RM verkauft. Auch den letzten Lohn von Siemens und Osram kassierte die Oberfinanzdirektion.
Von den rund 7000 bei der „Fabrik-Aktion“ verhafteten und deportierten Berliner Zwangsarbeitern wurden in Auschwitz lediglich 3000 nach Ausschwitz-Monowitz zur Arbeit in dem Zweigwerk Buna weitergeleitet, die anderen auf der Stelle in die Gaskammern geschickt. Vielleicht gehörten Walter und Ilse zu denen, die nicht sofort, sondern erst durch Schwerstarbeit unter unmenschlichen Bedingungen ermordet wurden – wir wissen es nicht, da wir ihr Todesdatum nicht kennen.
Ilses Vater Eugen Herzberg, seit 1938 zum zweiten Mal verwitwet, wurde am 24. August 1942 nach Theresienstadt deportiert und erlag den dort herrschenden elenden Lebensbedingungen am 1. März 1943 – dem gleichen Tag, an dem seine Tochter von Berlin aus nach Auschwitz verschleppt wurde. Für ihn liegt ein Stolperstein vor der Nassauischen Straße 54. Walters Eltern Bertha und Iwan Isaac Weile wurden am 11. September 1942 ebenfalls nach Theresienstadt deportiert. Iwan Weile starb dort 77-jährig wenige Tage nach Ankunft, am 17. September, offiziell an „Herzlähmung“, tatsächlich wohl infolge der katastrophalen Zustände bei der Deportation und im Lager. Die ein Jahr jüngere Bertha Weile musste diese Umstände noch viele Monate ertragen, bis auch sie an Hunger, Kälte und fehlender Hygiene am 10. April 1944 starb. Walters Bruder Leonhard und seine Frau Mimi geb. Hedeman
nahmen sich am 18. Dezember 1941 gemeinsam das Leben, Julius Weile und Therese, geb. Fröhlich flohen nach Amsterdam, wurde aber dort von den Nationalsozialisten aufgegriffen, möglicherweise getrennt, denn Julius wurde am 18. Januar 1944 vom KZ Westerbork aus zunächst nach Theresienstadt – vielleicht konnte er dort noch einmal seine Mutter sehen -, am 28. September dann nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Von Therese weiß man nur, dass sie am 7. November 1943 im Niederländischen KZ Vught-Hertogenbosch ermordet wurde. Der älteste Bruder, Max Weile, und die Schwester Cäcile konnten rechtzeitig Deutschland verlassen und überlebten.
Recherchen und Text: Dr. Micaela Haas.
Quellen: Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Akten der Oberfinanzdirektion; Yad Vashem, Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005