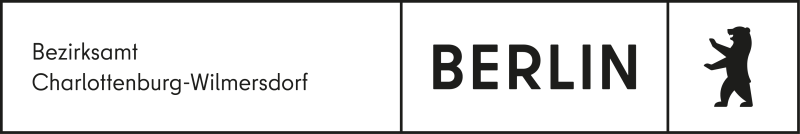Naturtheater “Gustav-Böß-Bühne”
Nach der Parkeröffnung 1923 wurde das ebenfalls von Erwin Barth nach dem Vorbild des antiken Theaters in Ephesos entworfene Freilufttheater, die Gustav-Böß-Bühne errichtet. Es fasst 2000 Besucher. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt. Kassengebäude und Umkleideräume wurden 1951 errichtet.
Seit Mai 2004 bietet die Scampi & Steak Company im “Kulturbiergarten Jungfernheide” sowohl den klassischen Biergarten mit Fassbier, Weisse oder Milchkaffee als auch Unterhaltung an. Auf einer Großbildleinwand werden die Bundesligaspiele und andere sportliche Ereignisse gezeigt.
Die Bühne wurde benannt nach Gustav Böß, der im Januar 1921 Oberbürgermeister von Berlin wurde. Bereits als Stadtkämmerer hatte sich dieser um solide Grundlagen für die städtischen Finanzen gekümmert. Die daraus resultierenden unpopulären Maßnahmen hatten ihm nicht immer den ungeteilten Beifall der Stadtverordneten eingebracht. Als Leiter der Stadtverwaltung legte er schon Anfang 1922 ein langfristiges Programm vor, das die großzügige Anlage von Parks sowie Spiel- und Sportplätzen vorsah. Die Wirtschaft sollte durch freiwillige Spenden die Durchführung dieses für die Volksgesundheit so wichtigen Planes ermöglichen. Vorbildliche Anlagen entstanden mit dem Volkspark Rehberge, dem anschließenden Goethepark und wie wir gesehen haben mit dem Volkspark Jungfernheide.
Die gleichen sozialen Gründe bewogen den Oberbürgermeister, sein Augenmerk dem Wohnungsbau zuzuwenden. Bis 1930 wurden über 135000 Wohnungen fertiggestellt. Auch die Siemensstadt erhielt damals ihre endgültige Gestalt, doch konnte die Bautätigkeit mit dem raschen Bevölkerungsanstieg, der durch Zuwanderung bedingt war, nicht Schritt halten. Eine glänzende Leistung, wodurch Berlin freilich schwer verschuldete, war der in die Zukunft gerichtete Ausbau des Nahverkehrsnetzes. Ernst Reuters Wirken unter Gustav Böß als Stadtrat für Verkehrswesen war es zu verdanken, dass die Berliner Straßenbahn-Betriebs GmbH, die Allgemeine Berliner Omnibus AG (ABOAG) sowie die Hoch- und Untergrundbahnen 1928 in der BVG vereinigt wurden. 1929 wurden Stadt- und Ringbahn elektrifiziert. Dadurch konnte die landschaftlich schöne Umgebung dem Berliner Ausflugsverkehr erschlossen werden.
Trotz dieser unbestreitbar großen Verdienste der Stadtverwaltung,die in einer äußerst schweren Zeit arbeiten musste und dabei die tragfähigen Grundlagen für das heutige Berlin schuf, führte der Sklarek-Skandal zum Sturz des Oberbürgermeisters Böß.
Anfang 1929 gerieten zwei stadtbekannte jüdische Kaufleute aus Osteuropa, Leo und Willy Sklarek ins Visier polizeilicher Ermittler. Ihre Textilfirma belieferte die Stadt Berlin mit Uniformen und anderen Textilartikeln. Die Polizei trug Beweise für kriminelle Handlungen wie Diebstahl, Unterschlagung und Bestechung gegen sie zusammen. Die Sklareks, Emporkömmlinge wie aus dem Bilderbuch, bewohnten hochherrschaftliche Villen im Westend, fuhren schicke Autos, besaßen eine Anzahl eigener Rennpferde und erkauften sich das Wohlwollen, das sie benötigten, um in ihren Geschäften einigermaßen freie Hand zu haben, durch Schmiergeldzahlungen an ausgewählte Beamte. Offenbar verteilten sie diese Gelder aber nicht in der nötigen Breite, denn irgendwann nahm die Polizei sie unter dem Verdacht der Hehlerei fest.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Brüder dem Oberbürgermeister Boß einen für seine Frau bestimmten Pelzmantel geschickt hatten, ohne eine Rechnung dafür zu stellen. Dem Bürgermeister musste zugute gehalten werden, dass er mehrmals angeboten hatte, den Mantel zu bezahlen, bis die Gebrüder ihm schließlich eine Rechnung über 375 Mark geschickt hatten, was, wie er wohl wusste, ein viel zu niedriger Preis war. Er behalf sich damit, dass er den Sklareks zusätzlich 1000 Mark überwies mit der Bitte, das Geld für den Ankauf eines Gemäldes für seine geliebte Städtische Galerie zu verwenden. Das taten sie zwar, aber da der Mantel eigentlich 4950 Mark wert war, bestand noch immer der Eindruck, Böß sei in den Genuss eines Sonderangebots gekommen, wie es einem Nicht-Amtsträger niemals angedient worden wäre. Als die Affäre im September 1929 an die Öffentlichkeit drang, griffen all die Parteien, die sich dem liberalen Kurs, den Böß steuerte,
schon seit langem widersetzt hatten, die Vorgänge auf, um ihn politisch in die Enge zu treiben. Die Kommunisten nannten ihn einen typischen kapitalistischen Gauner, Goebbels bezichtigte ihn in Der Angriff als einen, der mit den Juden das Bett teile.
Der Oberbürgermeister selbst befand sich, als der Skandal ruchbar wurde, gerade auf einer Amerikareise und beeilte sich nicht, zurückzukommen und seinen Anschuldigern ins Auge zu sehen. Er war in die USA gereist, um günstigere Kreditmöglichkeiten für die hoch verschuldete Stadt Berlin zu erkunden, die sich bereits mit kurzfristigen Auslandskrediten verschulden musste. Die Reise verlief hoffnungsvoll, aber die Rückkehr endete in einem Fiasko:
Als er schließlich in Berlin eintraf, wurde er von einer pöbelnden Menge empfangen, die ihm eine Abreibung zu erteilen versuchte. Gedemütigt und angewidert ließ er sich frühpensionieren. Er kehrte nie in sein Amt zurück. Die Sklareks wanderten für vier Jahre ins Gefängnis.
Die eindrucksvolle Leistungsbilanz der Amtsjahre von Gustav Böß ging im Skandal unter. Das Ansehen der städtischen Verwaltung und der demokratischen Verwaltung überhaupt waren nachhaltig geschädigt, auch wenn Böß später vor Gericht vom Verdacht der Bestechlichkeit rehabilitiert wurde.
Anhang
Weitere Infotafeltexte
Tafel 7, Heckerdamm 291
Paul Rudolf Henning
Die Bauten von Paul Rudolf Henning gehören zur Erweiterung der Siedlung auf dem zum Volkspark hin abfallenden Gelände, mit der 1930/31 bereits kurz nach Fertigstellung des I. Bauabschnitts begonnen wurde. Drei gleich lange, dreigeschossige Wohnzeilen werden nach Norden hin in zweigeschossiger Höhe weitergeführt und ermöglichen so einen sanften Übergang in den Volkspark.
“Die Herabzonung der Reihe im Norden in zweigeschossige Bauten sucht Anpassung und Überleitung in den freien Baumbewuchs des anschließenden öffentlichen Parks Jungfernheide. (…) In den zweigeschossigen Häusern hat jeder Bewohner einen Anteil an den Dachterrassen, die auf Wunsch des Bezirks für Kranke eingerichtet wurden”, schrieb Henning dazu. Ein kürzerer Block mit vier Etagen schloss die Bebauung nach Westen hin ab. Da dieser II. Bauabschnitt im Rahmen des regulären Finanzierungssystems errichtet wurde, unterlag er damit den strengeren baulichen Bestimmungen der Wohnungsfürsorgegesellschaft. Dieser Umstand verbot leider die Entwicklung neuer Grundrisslösungen.
Hennings Zeilen greifen Material und Tongebung der südlich gelegenen Blöcke Härings auf und bilden mit ihnen – leicht versetzt zueinander liegend – farblich abgestimmte Hausreihen, die von den weißen Gebäuden Forbats im Osten und Gropius’ im Westen eingerahmt werden. Während die Hauseingänge an der eher flächig aufgefassten Ostseite liegen, wird an der westlichen Hauptansichtsseite Hennings Ausbildung als Bildhauer erfahrbar: Querrechteckige, an den Ecken abgerundete Balkone, die jeweils Platz für fünf Stühle bieten, treten selbstbewusst aus der Fassade hervor und lassen die Gebäude fast wie gebaute Skulptur erscheinen. Die größeren Wohnungen an den Südseiten haben anstelle der Balkone breite Blumenfenster, die – nach Henning – “neben einem freien Ausblick auf die vorgelagerte Wiese dem Grundriss ein Höchstmaß von Helle und Weiträumigkeit” geben sollen.
Henning erweiterte in den Jahren 1933/34 seine Zeilenbebauung im Westen um zwei spiegelbildlich angeordnete, balkonlose Blöcke.
Paul Rudolf Henning
1886 Berlin- 1986 Berlin
Architekt und Bildhauer
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg schuf Paul Rudolf Henning erste bauplastische Arbeiten zusammen mit den Architekten Emil Schaudt, Otto Rudolf Salvisberg u.a.. Er zog 1916 nach Zürich, wo er Kontakte zu DADA Zürich knüpfte; 1919 wurde er Mitglied im Berliner “Arbeitsrat für Kunst”. Erneute Zusasmmenarbeit mit Salvisberg, auch mit Erich Mendelsohn. Er blieb auch nach 1933 in Berlin; sei weiterer Werdegang kann als beispielhaft für viele, weniger prominente “moderne” Architekten gelten, die nicht emigrierten. Neben verstärkter Tätigkeit im Industriebau erweiterte er 1933/34 die Siedlung Siemensstadt nach vereinfachtem Entwurf. Andere Arbeiten wandten sich von seinen modernen Gestaltungsgrundsätzen ab. Die Bauten der Nachkriegszeit nahmen dann wieder Elemente seiner progressiven Arbeiten auf.
Tafel 8, Geißlerpfad 11
Fred Forbat
Fred Forbat konnte in beiden Bauabschnitten sehr unterschiedliche Zeilenbauten errichten. Sein erster Wohnblock schließt die Häring’sche Zeilenbebauung nach Osten zum Geißlerpfad hin ab. Seine Zeile hat an der Eingangsseite eine Ziegelverblendung in Erdgeschosshöhe, die auch in den angebauten Läden am Süd- und Nordende fortgesetzt wird, während die Gartenseite weniger plastisch formuliert wird. Kurz nach Fertigstellung des I. Bauabschnittes wurde mit der Erweiterung der Siedlung begonnen. Forbat fiel die dankbare Aufgabe zu, einen viergeschossigen Brückenbau zu entwerfen, der den zentralen Gründstreifen der Anlage nach Osten abgrenzt. Nach Norden schließt sich eine dreistöckige, leicht abknickende Zeile an. Ragen an der Straße lediglich die vorspringenden Dächer der Hauseingänge hervor, so öffnen sich an der Gartenseite Loggien in der ganzen Wohnungsbreite und geben “ungestörte Aussicht auf die Hauptgrünfläche ohne jedes Gegenüber” – wie
Forbat formuliert.
Der dreigeschossige nördliche Blockabschnitt schließt die Siedlung nach Osten ab. Die asymmetrisch aufgefasste Straßenseite erhält ihre plastische Wirkung durch abgerundete, leicht vortretende Gebäudeteile, die zusammen mit den durchgehend verglasten Treppenhäusern dem Block eine vertikale Gliederung geben. Der Wohnblock enthält pro Etage eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern und eine geräumigere mit variablen Grundrisslösungen, über die Forbat schrieb: “Durch Weglassen der einen oder der anderen Zwischenwand und in einem Fall durch Umlegen der Küche neben das Bad sind drei weitere Abwandlungen für andersgeartete Wohnbedürfnisse geschaffen worden.” Alle vier Varianten wurden ausgeführt.
Mit großem Gespür für das Detail schaffte es Forbat, eine sorgfältig gestaltete und zugleich klar gegliederte Architektur zu verwirklichen, die leider heute immer noch zu wenig beachtet wird und wegen ihrer Freiheiten zum Geheimtipp unter Architekturinteressierten geworden ist.
Die von Forbat geplante umfangreiche Erweiterung der Siedlung nach Osten, die mit niedrigen Ladenbauten den Goebelplatz zu einem Einkaufszentrum aufwerten sollte, kam nicht zur Ausführung.
Fred Forbat
1897 Pecs, Ungarn – 1972 Stockholm
Architekt und Stadtplaner
Fred Forbat arbeitete von 1920-1922 im Atelier von Walter Gropius, 1925-1928 als Chefarchitekt im Baukonzern von Adolf Sommerfeld in Berlin. 1930 nahm er einen Siedlungs- und Städtebau-Lehrauftrag an der Itten-Schule an.
1932 ging er als Mitarbeiter der staatlichen Städtebauorganisation “standardgorprojekt” in die UdSSR.
1933 war er Grabungsarchitekt des Deutschen Archäologischen Institutes in Olympia, dann freier Architekt in Pecs.
1938 emigrierte er nach Schweden, war im Städtebau in Lund und Stockholm tätig und Professor an der TH Stockholm.
Tafel 10, Heilmannring 60
Hier ist auf einer großen refliefartigen Bronzetafel auf einer Betonplatte ein Überblicksplan von Siemensstadt zu sehen. Dahinter steht die Infotafel Nr.10
Tafeltext:
Hans Scharoun “Atelier und Wohngehöfte”
Hans Scharoun entwickelte als Stadtrat und Leiter eines Planungskollektivs 1945/46 richtungsweisende Konzeptionen für den Wiederaufbau Berlins, bei denen er auf seine Erfahrungen in Siemensstadt 1930 zurückgreifen konnte. In Charlottenburg-Nord konnte er diese Ideen zumindest ansatzweise verwirklichen.
Scharouns ursprüngliche Planung beruhte auf einer sozialstatistischen Untersuchung seiner Mitarbeiter am Institut für Städtebau der TU Berlin. Von den “gewachsenen” Vierteln des alten Berlin ausgehend, wurden die Wohnbedürfnisse der verschiedensten Bevölkerungsgruppen aufgenommen, vom Alleinstehenden bis zur Großfamilie. Der soziale Querschnitt sollte Arbeiter, Angestellte, Selbständige und Akademiker umfassen.
In so genannten Wohngehöften, um Grünanlagen gruppierte ein- bis elfgeschossige Gebäude, sollten jeweils 649 Bewohner Platz finden. Neben Wohnungen sah Scharoun auch Kultureinrichtungen, z.B. Kinos und Restaurants, vor. In den bei Mietern wenig beliebten Erdgeschossen sollten Gewerbebetriebe untergebracht werden – Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Insgesamt ergab sich damit fast jene “Kreuzberger Mischung”, deren Wert für Stadtbildung und menschliches Zusammenleben erst mit der “Internationalen Bauausstellung” von 1984/87 wieder entdeckt wurde.
Die Teilung des Gesamtgeländes in zwei Planungsbereiche, von denen die GSW nur den südlichen zugewiesen bekam, und die strengen Vorschriften für den “Sozialen Wohnungsbau” ließen nur eine vereinfachte Form der Wohngehörte zu. Aus der erzwungenen Weiternutzung des im Nationalsozialismus bereits angelegten Kanalisationssystems war die Straßenführung des Heilmannrings vorgegeben, der die Wohngehöfte zusätzlich in einen Nord- und einen Südteil zerschnitt.
Die ursprünglich durch die Gebäudeteile gefassten grünen Höfe sind in der Ausführung nach Norden und Süden hin geöffnet, die Gebäudeteile ähneln dadurch gebogenen Zeilenbauten.
Dennoch gelang es Hans Scharoun mit der Unterstützung des neuen GSW-Direktors Walther Großmann, neue Ideen zu verwirklichen, indem er einige Grundrisse für Wohngemeinschaften vorsah und an den großzügigen Treppenhausdielen verschiedenen große Wohnungen nebeneinander legte, was die gegenseitige nachbarschaftliche Hilfe bei der Betreuung von Kranken, Alten und Kindern erleichtern sollte. Da die GSW aber die zusätzlichen Einrichtungen wie Gewerberäume und kulturelle Institutionen – wegen ihrer Gemeinnützigkeit – nicht bauen durfte, ist bei den Wohngehöften letztlich alles entfallen, was das Wort “Gehöft” beinhaltete. Scharouns visionäre Konzepte, die sozialstatistischen Untersuchungen, die Mischung von Wohnen und Arbeiten und die “Nachbarschaften” sind heute aber aktueller denn je, alle anspruchsvollen Stadtsanierungen und –planungen folgen heute seinen Überlegungen.
Auf einigen Dächern konnte Scharoun doppelgeschossige Atelierwohnungen bauen, von denen er eine selbst bis zu seinem Tode als Wohn- und Arbeitsort nutzte. Der Atelierteil dieser Wohnung ist noch erhalten.
Hans Scharoun
1893 Bremen – 1972 Berlin
Architekt
Mit den Planungen zur Großsiedlung Siemensstadt fand Scharoun erstmals weltweite Beachtung. nach dem Studium in Berlin war er von 1919-1925 als freier Architekt in Insterburg/Ostpreußen und von 1925 bis 1932 als Professor an der Kunstakademie in Breslau tätig. Er gehörte 1919/20 zur “Gläsernen Kette” und schloss sich 1926 der Architektenvereinigung “Der Ring” an. Nach expressionistischen Anfängen war er neben Hugo Häring Vertreter des organischen Bauens. Nicht emigriert, baute er nach 1933 vor allem Privatwohnhäuser. Als Stadtrat und Leiter eines Planungskollektivs (1945/46) entwickelte er richtungsweisende Konzeptionen für den Wiederaufbau Berlins, die er zumindest in Ansätzen in der an Siemensstadt anschließenden Siedlung Charlottenburg-Nord verwirklichen konnte. Als architektonisches Hauptwerk gilt das Gebäude der Philhamonie in Berlin (1956 bis 1963). Von 1946-1958 hatte er eine Professur an der TU Berlin, von 1947-1950 leitete er das
Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften und von 1955-1968 war er Mitglied und Präsident der Akademie der Künste, später ihr Ehrenpräsident.