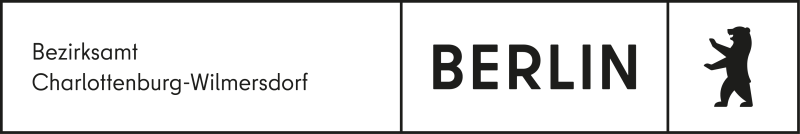Treffpunkt: 13.00 Uhr vor dem Jüdischen Gemeindehaus, Fasanenstr. 79/80
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Monika Thiemen. Ich bin die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf und begrüße Sie herzlich zu dieser Rundfahrt durch unseren Bezirk. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser besonderen Rundfahrt. Wir wollen an das erinnern, was heute vor 70 Jahren hier bei uns geschah. Es ist für uns noch immer unfassbar und scheint in einer finsteren Vorzeit geschehen zu sein, aber es leben noch Menschen unter uns, die es selbst erlebt haben.
Einer von ihnen ist Isaac Behar. Er ist in diesem Jahr 85 Jahre alt geworden und besucht noch immer als Zeitzeuge unsere Schulen, um den Schülerinnen und Schülern seine Erlebnisse von damals zu erzählen. Er wollte eigentlich heute am Anfang dabei sein und Ihnen davon berichten, wie er hier in der Fasanenstraße die Synagoge hat brennen sehen. Wegen anderen Terminen musste er uns absagen. Er hat damals mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern hier an der Ecke Fasanenstraße und Kantstraße gelebt, und er kann sich daran erinnern, wie er versuchte, seine Mutter zu trösten, die am Morgen des 10. November 1938 weinte, als sie den Lichtschein der brennenden Synagoge sah. Er sagte zur ihr: “Das sind doch nur Steine.” Sie antwortete ihm: “Wenn erst einmal Steine brennen, dann brennen auch bald Menschen.”
Vor dem Haus an der Kantstraße 154a erinnern vier Stolpersteine an die Eltern Nissim und Lea und an die Schwestern Alegrina und Jeanne Behar. Alle vier wurden 1942 deportiert und in Riga ermordet. Isaac Behar ist der einzige Überlebende der Familie.
Fasanenstr.79/80 Synagoge und Haus der Jüdischen Gemeinde
1910-1912 baute Ehrenfried Hessel hier die große Synagoge der Jüdischen Gemeinde Charlottenburg als dreischiffigen Monumentalbau mit drei Kuppeln und einem Tonnengewölbe. Stilistisch orientierte sich das Haus an frühchristlich-byzantinischen Kirchenbauten. Die Synagoge bot 2.000 Menschen Platz. Sie wurde am 26.8.1912 eingeweiht. Kaiser Wilhelm II kam zwar nicht zur Einweihung, aber er besuchte die Synagoge einige Tage danach. Es war die erste große Synagoge außerhalb des alten Berlins, und neben der Synagoge in der Oranienburger Straße war es die berühmteste in Berlin. Sie kündete vom Selbstbewusstsein des liberalen jüdischen Bürgertums: Nicht mehr versteckt im Hinterhof wie noch die wenige Jahre zuvor geweihte Synagoge in der Rykestraße, sondern als sichtbares Zeichen im Stadtbild. Von 1912 bis 1938 war Julius Galliner Gemeinderabbiner.
In der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde die Synagoge angezündet und brannte aus. 1957/58 wurde die Ruine abgerissen. An ihrer Stelle bauten Dieter Knoblauch und Hans Heise 1958-60 das Jüdische Gemeindehaus.
Es ist eine kreuzförmige Anlage mit einem Saalbau und einem langgestrecktem Verwaltungstrakt. Der Saalbau erinnert mit drei Oberlichtkuppeln an die zerstörte Synagoge.
Am Portal erinnern Reste der alten Portalbekrönung an die Synagoge. Im Vorhof wurde 1987 ein Mahnmal von Richard Hess in Form einer stilisierten Torarolle aufgestellt. Im Foyer gibt es Gedenktafeln unter anderem für Walther Rathenau, Richard Tauber, Josef Schmidt und eine Büste von Moses Mendelssohn. Im Innenhof trägt eine Gedenkwand die Namen von 22 Ghettos, Internierungs-, Konzentrations- und Vernichtungslagern, davor brennt eine Ewige Flamme.
Hier werden Gedenkveranstaltungen abgehalten und das Kaddisch, das jüdische Trauergebet, gesprochen. Im Juli 2006 verlegte die Jüdische Gemeinde ihren Sitz in das Centrum Judaicum an der Oranienburger Straße im Bezirk Mitte. Hier im Gemeindehaus in der Fasanenstraße bleiben der Seniorentreff, die Gemeindebibliothek, die Jüdische Volkshochschule und das koschere Restaurant Arche Noah.
Ein Charlottenburger Augenzeuge schrieb folgenden Bericht:
“Die Nacht vom 9. zum 10. November und den 10. November 1938 kann niemand aus dem Gedächtnis löschen, der die entfesselte Unterwelt aus dem Abgrund steigen sah. Mit Knüppeln und langen Stangen, johlend und lachend, brachen sie auf dem Kurfürstendamm, in seinen Nebenstraßen und in der Tauentzienstraße in die Geschäfte, Büros und Wohnungen der jüdischen Einwohner ein. Wie aus dem Boden gewachsen tauchten plötzlich Hunderte von jungen Burschen auf, die an ihrer SA-Herkunft nur durch die Schaftstiefel zu erkennen waren, verteilten sich nach einem festgelegten Plan auf beiden Seiten des Kurfürstendammes und zertrümmerten die großen Schaufenster der jüdischen Geschäfte.
Andere Trupps zogen nach der Fasanenstraße und begingen das schändlichste Werk der an Verbrechen reichen Nacht: Sie drangen in das Gotteshaus, in die Synagoge ein und setzten sie in Brand. Hoch loderten die Flammen als, von empörten Passanten alarmiert, die Feuerwehr eintraf. Und dann geschah das Unfassbare, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt: Die Feuerwehr durfte nicht löschen, die Polizei durfte nicht den Mob verjagen! Hilflos standen die Löschmannschaften vor der brennenden Synagoge: Die SA-Männer hinderten sie am Auslegen der Schläuche, und die Polizei drehte dem schamlosen Schauspiel den Rücken.”
Der heutige Direktor des Jüdischen Museums, Michael Blumenthal, hat den 9. November 1938 als 12jähriger erlebt:
“Unser Geschäft wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 demoliert; meine Mutter ging gleich in der Früh los, um zu retten, was vielleicht noch zu retten war. Ich hatte strikte Anweisung, das Haus nicht zu verlassen. Aber ich war zu aufgeregt und musste einfach sehen, was los war.
Ich rannte den Kurfürstendamm entlang zur Synagoge in der Fasanenstraße. Überall standen Neugierige und starrten auf die unvorstellbare Verwüstung. Jedes jüdische Geschäft war demoliert worden, die Bürgersteige waren mit Glasscherben übersät, Läden waren geplündert und einige in Brand gesteckt worden. Aus Richtung der Synagoge sah man Rauchwolken aufsteigen.
Den Anblick, der mich dort erwartete, habe ich nie vergessen. Der schönste Tempel von Berlin war nur noch eine rauchende Ruine, Schutt lag auf der Straße, und die Feuerwehr sorgte bloß dafür, dass das Feuer nicht auf die benachbarten Gebäude übergriff. Eine große Menschenmenge stand hinter den Polizeiabsperrungen und schaute stumm zu. Der Anblick war sogar für ein Kind meines Alters unheimlich; ich hatte zum ersten Mal richtig Angst, macht kehrt und rannte nach Hause. Vor einigen jüdischen Geschäften versuchten die Eigentümer, Schutt und Glasscherben zusammen zu kehren. Niemand half ihnen, die Menschen schauten hin und gingen weiter; sie schienen angesichts dessen, was sie sahen, ebenso sprachlos und verstört zu sein wie ich selbst.”
Blumenthal emigrierte 1939 zunächst nach Shanghai, dann in die USA.
Um die Ecke auf dem Gelände des heutigen Kant-Dreiecks an der Kantstraße 158 befand sich von 1928 bis 1943 das Haus der zentralen jüdischen Organisationen. Zunächst hatte dort der 1922 gegründete Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden PLV hier seinen Sitz. 1933 zog die Reichsvertretung der deutschen Juden in das Gebäude ein. Präsident war der Rabbiner Leo Baeck. Dazu kamen der Jüdische Frauenbund e.V. und mehrere Wohlfahrtseinrichtungen wie die Zentralstelle für jüdische Wohlfahrtshilfe, die Vereinigte Zentrale für jüdische Arbeitsnachweise und die Zentralstelle für die jüdischen Darlehenskassen.
Von hier aus versuchte die Reichsvereinigung bzw. Reichsvertretung der deutschen Juden trotz zunehmender Diskriminierungen und Verfolgungen durch das NS-Regime die jüdische Schulverwaltung zu organisieren, Auswanderungen zu fördern und den jüdischen Auswanderern eine geeignete Ausbildung zukommen zu lassen, die jüdische Wohlfahrtspflege aufrechtzuerhalten und den jüdischen Bürgern Arbeitsplätze zu vermitteln oder zu erhalten.
Auch die anderen im Haus ansässigen Organisationen versuchten mit eigenen Mitteln, den immer mehr entrechteten und verarmten Jüdinnen und Juden zu helfen – anfangs noch beim Aufbau einer neuen kleinen Existenz, nachdem sie von ihren Arbeitgebern entlassen worden waren. Später ging es nur noch darum, die Auswanderung zu organisieren, einen Start im Ausland zu erleichtern und diejenigen zu versorgen, die trotz der katastrophalen Lebensbedingungen nicht emigrieren konnten oder wollten.
Das Palästina-Amt der Jewish Agency for Palästina, dessen Aufgabe in der Betreuung und Förderung der Auswanderung nach Palästina bestand, zog 1938 aus der Meinekestraße 10 ebenfalls in das Haus der zentralen jüdischen Organisationen.
Im Juni 1943 schloss die Gestapo das Haus und beschlagnahmte das gesamte jüdische Vermögen.
Fasanenstraße
Fasanenstraße Ecke Kurfürstendamm 27 Kempinski
1994 hat ein Nachkomme der Familie Kempinski durchgesetzt, dass an dem Hotel eine Gedenktafel angebracht wurde. Die Messingtafel ist links neben dem Eingang zu sehen. Der Text lautet:
HIER STAND SEIT 1928 EIN
KEMPINSKI-RESTAURANT.
ES WAR EIN WELTWEIT
BEKANNTES SYMBOL
BERLINER GASTLICHKEIT.
WEIL DIE BESITZER JUDEN
WAREN, WURDE DIESE
BERÜHMTE GASTSTÄTTE
1937 “ARISIERT”,
UNTER ZWANG VERKAUFT.
ANGEHÖRIGE DER
FAMILIE KEMPINSKI
WURDEN UMGEBRACHT,
ANDERE KONNTEN FLIEHEN.
DAS 1952 ERÖFFNETE
BRISTOL HOTEL KEMPINSKI
MÖCHTE, DASS DAS SCHICKSAL
DER GRÜNDERFAMILIE
NICHT VERGESSEN WIRD
Kurfürstendamm (links)
Kurfürstendamm 217 (Ecke Fasanenstraße): Ehem. Nelson-Revue, Astor-Kino
Diagonal gegenüber dem Kempinski befand sich von 1921 bis 1928 die Nelson-Revue. Der überaus populäre Komponist und Theatermann zeigte hier seine Revuen mit moderner Unterhaltungsmusik und geistvollen literarischen Texten von Walter Mehring, Kurt Tucholsky und anderen. 1926 trat hier Josephine Baker erstmals in Berlin auf. Nelson emigrierte 1933 über Zürich nach Amsterdam. Die Revue wurde von den Nationalsozialisten geschlossen und 1934 zum Astor-Kino umgebaut.
Die Journalistin Ruth Andreas-Friedrich hat am Donnerstag, dem 10. November 1938 in ihr Tagebuch notiert:
“Um sieben Uhr früh läutet es. Vor der Tür steht Dr. Weißmann, der Rechtsanwalt und berichtet fassungslos: ‘Wie Hasen werden wir gejagt. Den halben Kurfürstendamm entlang haben sie mich laufen lassen. Judenschwein! Massenmörder! Verrecke, du Aas! mir nachgebrüllt. Mit Steinen auf mich geworfen und mit Dreckklumpen.’
Um halb zehn fahre ich in die Redaktion. Der Kurfürstendamm ist ein einziges Scherbenmeer. An der Ecke Fasanenstraße stauen sich die Menschen. Eine stumme Masse, die betreten in Richtung der Synagoge starrt, deren Kuppel von Rauchwolken verhüllt ist.”
Am 16. November schilderte der kolumbianische Botschafter in Berlin, Jaime Jaramillo Arango, der am Kurfürstendamm wohnte, dem Außenminister seines Landes, Luis López de Mesa, was er in der Nacht vom 9. zum 10.11.1938 erlebt hatte. Er berichtet, dass “eine Gruppe von Leuten, die mit Eisenstangen ausgerüstet war, alle großen Geschäfte, die sich in dieser Straße befanden, systematisch einschlug… Die Zerstörung war gegen israelitisches Eigentum gerichtet, und weil ich langsam und diskret mit meinem Auto fuhr, konnte ich beobachten, wie entlang dieser Straße diese barbarischen Handlungen durchgeführt wurden. Einige der Randalierer haben die Scheiben eingeschlagen, während andere eindrangen, um die dort vorhandenen Möbel zu zerstören und die Waren auf die Straße zu werfen, wo sie … plünderten. Hier und dort an den Ecken, geschützt durch die Dunkelheit, standen einige Autos, von denen Personen mit den schwarzen Uniformen der S.S. … Anordnungen gaben und die widerliche Verwüstung leiteten. das Spektakel, das die Hauptader Berlins zeigte, war wahrlich entsetzlich, die zerstörten Glasscheiben über den ganzen Bürgersteig verstreut, die Waren zerfetzt und im Innern der Kaufhäuser die Trümmer. So kam es, dass die Bevölkerung Berlins am nächsten Morgen der größten Demonstration von Vandalismus unserer modernen Zeiten beiwohnen musste.”
Der ungarische Geschäftsträger in Berlin, Gesandtschaftsrat Jenö Ghyczy, teilte seiner Regierung am 12. November 1938 mit: “Im Laufe des gestrigen Nachmittags und Abends zogen große neugierige Menschenmassen durch die Straße und betrachteten ernst und stumm den Schauplatz der Verwüstungen. Man hatte das Gefühl, dass sich hier ein ganzes Volk schämte.”
Ecke Joachimstaler Straße:Ehem. Wäschehaus Grünfeld, heute Ku’damm-Eck
Diagonal gegenüber dem Café Kranzler eröffnete Heinrich Grünfeld 1928 eine sehr markante Filiale seines Wäschehauses Grünfeld. Das Stammhaus befand sich in der Leipziger Straße – dort setzte man auf Tradition, hier am Kurfürstendamm auf Moderne mit einer gläsernen Schaufensterfront und einem gläsernen Fahrstuhl, beides damals absolute Neuheiten. Hier kaufte die Prominenz aus Film, Theater, Musik, aus der Kunst- und Modewelt und Touristen aus dem Ausland. Die “Grünfeld-Ecke” wurde schnell zum Begriff in Berlin.
Fritz Grünfeld hat in seinen Erinnerungen beschrieben, wie er das Problem löste, als er im Jahr der Olympiade 1936 aufgefordert wurde, das Haus zu beflaggen: “Ein unbeflaggtes Haus an dieser prominenten Ecke hätte das ‘Anderssein’ des jüdischen Unternehmens zu deutlich gemacht. Andererseits konnten wir auch nicht die Hakenkreuzfahne hissen. So kam ich auf den Gedanken, die ganze attraktive Fassade mit Wimpeln wie bei einer Regatta ausschmücken zu lassen – und zwar abwechselnd in den zwei Farben ‘Wäsche-Weiß’ und ‘Grünfeld-Blau’. Das waren auch die Farben der zionistischen Bewegung. Sehr festlich wirkte der Anblick auf die Besucher der Olympiade zu Berlin”.
Im Jahr darauf, 1937, wurde das 75jährige Firmenjubiläum in großem Rahmen begangen. Unmittelbar nach diesem Erfolgs-Jubiläum begann im Jahr 1938 das Kesseltreiben gegen die Firma mit einer Hetzkampagne des Stürmers, der vor dem Kauf bei Grünfelds warnte. Danach wurde das Personal unter Druck gesetzt, Grünfeld zu verlassen. Die Presse druckte keine Anzeigen mehr, und Lieferanten boykottierten die Firma auf staatlichen Druck hin, die Banken sperrten die Kredite. Die Firma war nicht mehr zu halten. Die Grünfelds mussten einen Käufer suchen. Walther Kühl, Inhaber der Berliner Einzelhandelsfirma Max Kühl, kaufte das Unternehmen weit unter Wert. Und selbst dieser Verkaufserlös wurde der Familie Grünfeld von den deutschen Behörden wieder abgenommen, bevor sie – gerade noch rechtzeitig – nach Palästina auswandern konnte.
Am 15. Oktober 1938 meldete die “Textil-Zeitung”: “Grünfeld in arischem Besitz!” Das Haus Grünfeld wurde zunächst von Kühl weitergeführt, im Krieg beschlagnahmt und als Heereskleiderkasse zur Lagerung und Ausgabe von Uniformen benutzt. In den letzten Kriegstagen im April 1945 wurde das Gebäude von SS-Leuten angezündet, wahrscheinlich um zu verhindern, dass der Feind in den Besitz der Uniformen gelangte.
Max Kühl führte das Wäschekaufhaus in der Nachkriegszeit am Kurfürstendamm Ecke Fasanenstraße weiter. Die Ruine des Wäschehauses Grünfeld wurde noch bis in die 60er Jahre als dreistöckiger Behelfsbau genutzt.
1969-72 entstand dann das Kudamm-Eck von Senatsbaudirektor Werner Düttmann. Es wurde bald nach Fertigstellung als überdimensionierter hässlicher Schandfleck empfunden. In dem verwinkelten Gebäude konnte sich kein Nutzer auf Dauer erfolgreich behaupten, und viele wünschten sich schon in den 80er Jahren einen möglichst baldigen Abriss. Dazu kam es schließlich 1998. In den folgenden drei Jahren bis 2001 bauten Gerkan, Mark und Partner das heutige runde Kudamm-Eck.
( Joachimstaler Str. 13 Orthodoxe Synagoge
1901 baute Siegfried Kuznitzky das Quergebäude im Hof für die jüdische Loge B’nai B’rith (Bne Briss). 1925 wurde eine jüdische Volksschule eingerichtet. 1933 begründete der Bildungsverein der Jüdischen Reformgemeinde hier die Joseph-Lehmann-Schule, um den aus den deutschen Schulen ausgeschlossenen jüdischen Kindern Schulunterricht geben zu können. 1938 wurde das Quergebäude für den Gottesdienst der Liberalen und der Reformgemeinde umgebaut.
Der Betraum wurde nach 1945 wieder genutzt und 1955 renoviert. 1960 gab man ihn zugunsten des ehemaligen großen Logensaals im Erdgeschoss auf, der als Synagoge nach orthodoxem Ritus für 300 Personen eingerichtet wurde. Im Souterrain wurde ein rituelles Tauchbad eingebaut. Nach dem Bau der Mauer 1961 bezogen verschiedene Niederlassungen von jüdischen Organisationen das Haus, darunter der jüdische Nationalfonds und die Women’s International Zionist Organisation WIZO. Außerdem waren hier die Sozialabteilung, die Kultusverwaltung, die Büros der Rabbiner, das Jugendzentrum der Jüdischen Gemeinde und das Berliner Büro der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung untergebracht.
Im Erdgeschoss des Vorderhauses bietet die Literaturhandlung eine Auswahl an historischen, kulturhistorischen, theologischen und liturgischen jüdischen Büchern in deutscher und englischer Sprache an.)
Tauentzienstraße
Ein Pressefoto von den zerstörten Schaufenstern des Bettengeschäftes S. Kaliski & Co. am Tauentzien Ecke Nürnberger Straße wurde unter anderem in der New York Times am 20. November 1938 veröffentlicht. Es zeigt, wie die Scherben auf dem Gehweg vor dem Geschäft mit den zerstörten Scheiben zusammengefegt werden. Die damals 88jährige Seniorchefin Charlotte Kaliski und ihre Tochter Hedwig Silberberg mussten das Unternehmen schließen. Ihnen gelang gerade noch rechtzeitig die Flucht in die USA.
Die jüdischen Geschäfte waren für die Zerstörer gut zu finden; sie waren unmittelbar nach dem Erlass der Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938 gekennzeichnet worden.
Der amerikanisch Botschafter in Berlin, Hugh R. Wilson, telegrafierte am 22. Juni 1938 an Außenminister Cordell Hull: “Vom Spätnachmittag des Samstag (18.6.1938) an konnte man gewöhnlich aus zwei oder drei Männern bestehende Gruppen von Zivilisten beobachten, die an die Schaufenster jüdischer Geschäfte das Wort ‘Jude’ in großen roten Buchstaben, den Davidstern und Karikaturen von Juden malten. Auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße … wurde den Malenden die Arbeit dadurch erleichtert, dass am Vortag jüdische Geschäftsinhaber angewiesen worden waren, ihre Namen in weißen Buchstaben am Laden anzubringen.”
Unmittelbar nach der Pogromnacht begannen die “Maßnahmen zur Ausschaltung des jüdischen Einzelhandels”. Bis dahin hatten am Kurfürstendamm von der Knesebeckstraße bis zur Gedächtniskirche von 118 Ladengeschäften noch 25, also knapp ein Viertel jüdische Inhaber. Bis zur Jahreswende 1938/39 wurden die letzten Geschäfte “arisiert”. Vom 1.1.1939 an wurde Juden jeder Einzelhandelsbetrieb untersagt. Insgesamt hatte es in Berlin 1938 noch knapp 4.000 Geschäfte mit jüdischen Inhabern gegeben. 2/3 von ihnen wurden geschlossen, weil es keine ‘arischen’ Interessenten gab. Am Kurfürstendamm wurden alle Geschäfte weiter geführt, allerdings wurden aus Modegeschäften jetzt häufig Zigarren- Schreibmaschinen- oder Radioläden.
Rankestraße (rechts)
In der Rankestraße an der Gedächtniskirche war in den 1920er Jahren das Musikhaus Alberti. Es war eines der renommiertesten Schallplattengeschäfte der Stadt, umfasste in zwei Stockwerken ein internationales Repertoire, insbesondere englische und amerikanische Platten, was am Kurfürstendamm bis 1933 selbstverständlich war. Alberti gab eine eigene Hauszeitschrift, das “Musik-Echo” heraus.
1934 wurde darin die bornierte Nazi-Ideologie süffisant kommentiert, indem man darauf hinwies, dass das Saxophon keineswegs ein artfremdes Musikinstrument sein könne, wie die Nazis behaupteten, da es von einem ‘arischen’ Belgier, nämlich Adolf (!) Sax erfunden worden sei. Die Hauszeitschrift musste kurz danach eingestellt werden. Der Besitzer Alberti, ein Jude, floh 1934 aus Deutschland, und sein langjähriger Mitarbeiter, Herr Schalin, übernahm das Geschäft, behielt aber den Namen “Alberti” bei und kündigte öffentlich an, das Geschäft im alten Geiste weiterzuführen. Die Gestapo kontrollierte das Plattengeschäft häufig. Dennoch konnte eine gewisse Qualität des Sortiments bis in den Krieg hinein angeboten werden. Viele Platten – vor allem Jazzmusik – wurden jetzt unter dem Ladentisch gehandelt. 1942 wurden schließlich alle ausländischen Platten von der Gestapo beschlagnahmt. 1944 schlug eine Bombe ein, das Geschäft brannte aus – mitsamt
den Platten.
Lietzenburger Straße (rechts)
Joachimstaler Straße (links)
Bundesallee
Bundesallee 1-12: Ehemaliges Joachimsthalsches Gymnasium
Der klassizistische Bau wurde im Stil der italienischen Hochrenaissance 1875-80 von Ludwig Giersberg und Johann Eduard Jacobsthal für das bereits 1607 gegründete Joachimsthalsche Gymnasium gebaut, das sich damit aber finanziell übernommen hatte und 1912 wieder auszog. Bis 1919 wurde in dem Gebäude das Joachim-Friedrich-Gymnasium untergebracht. Seit 1920 nutzte es das Bezirksamt Wilmersdorf als “Stadthaus”. Das Rathaus Wilmersdorf an der Brandenburgischen Ecke Gasteiner Straße war zu klein geworden.
Wir haben das Verhalten des Bezirksamtes Wilmersdorf in der Zeit des Nationalsozialismus untersucht und die Ergebnisse 1992 in dem Buch “Kommunalverwaltung unterm Hakenkreuz” veröffentlicht. Leider mussten wir feststellen, dass es in diesem Bezirksamt von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen keinen Widerstand gab. Im Gegenteil: Der Begriff “Willige Vollstrecker”, der einige Jahre später geprägt wurde, trifft sowohl auf die politische Führung als auch auf die meisten Beschäftigen zu.
Wilmersdorf war in den 1920er und 30er Jahren der Berliner Bezirk mit dem höchsten Anteil jüdischer Bevölkerung. Damals lebten hier etwa 30.000 Juden, was einem Gesamtbevölkerungsanteil von etwa 13% entsprach, während er in ganz Berlin nur 3,8% betrug. Die Bezirksverwaltung tat seit 1933 alles, um die nationalsozialistischen Vorgaben zur Ausgrenzung und Diskriminierung der Juden umzusetzen, zum Teil sogar in vorauseilendem Gehorsam schon bevor entsprechende Verordnungen für ganz Berlin erlassen wurden. Bereits 1937 wurden beispielsweise in den öffentlichen Parks gelbe Bänke “nur für Juden” aufgestellt. Allerdings hat der Amtmann Riedler im Gartenbauamt Wilmersdorf diese Maßnahme ad absurdum geführt, indem er auf dem Prager Platz eine gelbe und eine normale Bank direkt einander gegenüber aufgestellt hat, so dass Juden und Nichtjuden sich direkt in die Augen sehen mussten. Er wurde dafür vom Nazi-Bürgermeister Petzke gerügt und in die Steuerkasse
strafversetzt.
Nach und nach führten alle Ämter getrennte Bereiche für Juden und Nichtjuden ein, und schließlich wurden fast überall Juden von den öffentlichen Leistungen ausgeschlossen, andererseits aber verstärkt überwacht und schikaniert. Nach der Pogromnacht des 9. November 1938 kontrollierte die Bauaufsicht die beschädigten Synagogen und verpflichtete die Jüdische Gemeinde, durch den Brand beschädigte Teile zu entfernen, damit Passanten nicht gefährdet würden.
Das Stadthaus wurde 1943 von Bomben getroffen und schwer beschädigt. Der größte Teil der Bezirksverwaltung zog in das heutige Goethe-Gymnasium in der Gasteiner Straße. 1955 wurde das ehemalige Joachimsthalsche Gymnasium etwas vereinfacht wiederhergestellt. Eine 1995 enthüllte Gedenktafel erinnert an die ehemaligen Schüler Paul von Hase, Ernst von Harnack und Erwin Planck, die ihren Widerstand gegen das NS-Regime mit dem Leben bezahlten.
Trautenaustraße (rechts)
Trautenaustr. 12 Gedenktafel für George Grosz
Hier lebte von 1928 bis 1933
GEORGE GROSZ
26.7.1893 – 6.7.1959
Maler und Graphiker. Bedeutender Satiriker, kämpfte gegen
Militarismus, Obrigkeitsstaat und Untertanenmentalität. Seine
Bilder wurden von den Nationalsozialisten als “entartete Kunst” verboten.
Emigration 1933, seit 1938 amerikanischer Staatsbürger.
Güntzelstraße (links)
Güntzelstr. 49: Stolpersteine
Der 1947 in Berlin geborene Kölner Bildhauer Gunter Demnig hat 1996 in Köln die ersten Stolpersteine verlegt, 10 × 10 cm große aus Beton gegossene Steine mit eingelassener Messingtafel, in die der Künstler mit Hammer und Schlagbuchstaben “Hier wohnte”, Namen, Jahrgang und Stichworte zum weiteren Schicksal eines einzelnen Menschen einstanzt. Die im Gehweg vor dem früheren Wohnort eingelassenen Stolpersteine sollen an die Opfer von Holocaust und Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Entscheidend ist dabei die persönliche Erinnerung an die Namen der Opfer. Inzwischen wurden in ganz Deutschland Tausende Stolpersteine verlegt. Allein in Charlottenburg-Wilmersdorf sind es mittlerweile 462, und in jedem Monat kommen neue hinzu.
Vor dem Haus Güntzelstraße 49 liegen 21 Stolpersteine. Sie erinnern an Betty, Hildegard und Erika Blum, Louis Casper, Gertrud Kalischer, Emil Efim Siedner, Lucie und Siegfried Zehden, Leopold und Gertrud Cohn, Hedwig und Ilse Heimann, Helene Werner, Georg Stodola, Sally und Martha Gross, Emma Friedländer, Carl Stern, Else Bloch, Charlotte und Max Auerbach. Alle wurden deportiert und in verschiedenen Konzentrationslagern ermordet mit Ausnahme von Sally und Martha Gross, die den Freitod wählten.
Landhausstraße (rechts)
Landhausstr. 37: Stolpersteine
Vor dem Haus Landhausstraße 37 liegen 6 Stolpersteine für Bruno und Toni Klein, Valentin und Ella Kroto, Meta Levinsohn und Fritz Moses. Auch sie wurden deportiert und ermordet bis auf Meta Levinsohn, die den Freitod wählte.
Landhausstr.26: Schwedische Kirche, Gedenktafel für Birger Forell
Hier, in der schwedischen Kirche war von 1929 bis 1942 Birger Forell Pfarrer. Auf einer Gedenktafel an der Kirche wird er als “Schützer und Retter vieler Verfolgter 1933-45” bezeichnet.
Er war Anhänger der Bekennenden Kirche und setzte sich für politisch Verfolgte des Nationalsozialismus ein. Die schwedische Kirche wurde zum geheimen Treffpunkt, bis die Gestapo aufmerksam wurde. 1942 musste Birger Forell Berlin verlassen. Aber auch sein Nachfolger, Pastor Perwe, engagierte sich für Verfolgte, unter anderem gemeinsam mit der Tierärztin Maria Gräfin von Maltzan, die von 1938 bis 1945 unweit von hier in der Detmolder Straße Ecke Weimarische Straße lebte. Sie versteckte in ihrer Wohnung zwischen 1942 und1945 verfolgte Jüdinnen und Juden und ermöglichte ihnen in Zusammenarbeit mit der schwedischen Victoriagemeinde in der Landhausstraße die Flucht aus Deutschland. Sie hat dabei nicht nur einmal ihr Leben riskiert. Pastor Perwe hat sie tatkräftig unterstützt. Die damalige deutsch-schwedische Zusammenarbeit erstreckte sich sogar auf staatliche Institutionen. Jedenfalls wusste der damalige schwedische Botschafter Arvid Richert Bescheid, und die deutschen
Polizeiwachtmeister vom Revier Landhausstraße schauten weg und gingen sogar vereinzelt soweit, die Kirche zu warnen, wenn Gefahr drohte. So konnten eine Reihe von Untergetauchten, sie wurden damals “U-Boote” genannt, in den Kriegsjahren 1942 bis 1945 außer Landes gebracht und gerettet werden. Meist waren es Möbeltransporte, in denen die Flüchtlinge versteckt wurden.
Berliner Straße (links)
(Unweit von hier lebte in der Weimarische Str. 6a von 1906 bis 1909 Victor Klemperer. Der Romanist, Literaturhistoriker und Publizist hinterließ mit seinen Tagebüchern aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur ein einmaliges Zeugnis über den Alltag der Judenverfolgung in einer deutschen Großstadt. Die Tagebücher von Victor Klemperer erzielten vor einigen Jahren in Deutschland Bestsellerauflagen, Er wurde zu einem der bekanntesten Zeitzeugen zum Alltag im Nationalsozialismus. Zu seiner Popularität hat viel beigetragen, dass sich bei ihm das oft ungläubige Staunen über die Brutalität der nationalsozialistischen Diktatur verbindet mit einer großen Liebe zu seiner deutschen Heimat. Auch dort, wo er persönlich betroffen war, suchte er noch wie ein nüchtern forschender Wissenschaftler nach Erklärungen.)
Prinzregentenstraße (rechts)
Prinzregentenstr. 69-70 Gedenktafel ehemalige Synagoge Wilmersdorf
Hier wurde am 9. November 1988 zum 50. Jahrestag der Pogromnacht eine Gedenktafel enthüllt.
An dieser Stelle stand einst
die Synagoge Wilmersdorf
erbaut von Alexander Beer 1928-1930
eingeweiht am 16.9.1930
angezündet und zerstört von
Nationalsozialisten am 9.November 1938
Die Pogromnacht
“hat nicht nur Glas zerschlagen,
sondern auch unsere Träume und Hoffnungen,
ein gesichertes Leben in unserem Heimatland
führen zu können”.
Rabbiner Manfred Swarsensky
Auf der Tafel ist eine Abbildung der Synagoge zu sehen.
Die einzige Gemeindesynagoge, die in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde, war gleichzeitig die modernste und eine der größten. Sie bot 2300 Personen Platz. Die Einweihungsfeier fand am 16. September 1930 statt, zwei Tage nachdem die NSDAP bei der Reichstagswahl einen Zuwachs von 12 auf 107 Sitze errungen hatte und mit 18,3 Prozent der Stimmen zur zweitstärksten Partei hinter der SPD geworden war.
Der Gemeindevorsitzende kommentierte das in seiner Festrede:
“Leider ist es in diesem Augenblick nicht möglich, sich restlos Gedanken des Stolzes und der Freude hinzugeben. Noch wissen wir nicht, welche Auswirkungen auf unsere Stellung und unser Leben diese Entscheidungen haben werden.”
Seit 1933 fanden hier viele Konzerte mit jüdischen Musikern statt, die aus dem allgemeinen Musikleben ausgeschlossen worden waren. Die jüdische Winterhilfe veranstaltete Konzerte, um für Bedürftige zu sammeln.
Am 9. November wurde die Synagoge angezündet und schwer beschädigt. Die Jüdische Gemeinde wurde danach von der damaligen Wilmersdorfer Bauaufsicht aufgefordert, die Schäden auf eigene Kosten zu beseitigen, damit Passanten auf dem Gehweg nicht gefährdet wurden. Der Architekt Alexander Beer musste daraufhin 8 Jahre nach dem Bau den Teilabriss der Synagoge organisieren. 1941 wurde die Jüdische Gemeinde gezwungen, das Grundstück an die Stadt Berlin zu verkaufen. Anfang 1938 war sein Wert noch auf mehr als 1,5 Millionen Reichsmark festgesetzt worden. Jetzt, drei Jahre später, erhielt die Jüdische Gemeinde dafür 160.000 Reichsmark. 1958 wurde die Ruine abgerissen und an ihrer Stelle das Wohnhaus des Allgemeinen Blindenvereins errichtet.
Prinzregentenstr. 66 Gedenktafel für Walter Benjamin
An dem Haus Prinzregentenstraße 66 erinnert eine Gedenktafel an den bedeutenden jüdischen Philosophen und Schriftsteller Walter Benjamin. Sie wurde 1989 enthüllt und enthält folgenden Text:
In dem früher hier stehenden Haus
lebte von 1930 bis zu seiner Emigration 1933
WALTER BENJAMIN
15.7.1892 – 27.9.1940
Literaturkritiker, Essayist und Philosoph,
schrieb hier Teile der “Berliner Kindheit um 1900”.
Freitod an der französisch-spanischen Grenze
wegen drohender Auslieferung an die Gestapo
Der brillante Kulturkritiker Walter Benjamin stammte aus einem wohlhabenden jüdischen Elternhaus. Mit seiner Familie folgte er dem für das wohlhabende Berliner Bürgertum um die Jahrhundertwende typischen Zug nach Westen. Die Familie lebte bis 1895 am Magdeburger Platz im Berliner Zentrum, zog dann in die Kurfürstenstraße im sogenannten Alten Westen, weiter an den Nettelbeckplatz, dann von 1902 bis 1912 in die Carmerstraße in Charlottenburg und schließlich in die Delbrückstraße 23 in der Villenkolonie Grunewald. Walter Benjamin bezog hier, in der Prinzregentenstraße 1930 im Alter von 38 Jahren seine erste eigene Wohnung, in der er allerdings nur 3 Jahre bleiben konnte.
In einem Brief an seinen Freund Gershom Scholem beschrieb er als eine der Merkwürdigkeiten seiner neuen Wohnung den “sehr weiten Blick über das alte zugeschüttete Wilmersdorfer Luch, oder wie es auch hieß, den Schrammschen See.” Damit ist der heutige Volkspark Wilmersdorf gemeint. Kurz nach der Einweihung der großen Wilmersdorfer Synagoge, die sich nur drei Häuser weiter in unmittelbarer Nachbarschaft befand, schrieb Benjamin an Scholem über die Vorteile seines Ateliers:
“Neben allen erdenklichen Vorzügen, vor allem dem der tiefsten Stille hat es architektonisch bemerkenswerteste Nachbarschaft; eine neue Synagoge, die ich, bis Rosch ha Schnah sie einweihte, für eine Ausgeburt protestantischen Theologengeistes im Kirchenbau hielt”.
Wexstraße (rechts)
Bundesallee (links)
Bundesplatz (ehem. Kaiserplatz)
Der Schriftsteller Georg Hermann hat in seinem 1908 erschienen Roman “Kubinke” lebendig beschrieben wie dieser Platz und diese Straße damals aussah:
“Die Häuser ringsum waren alle vornehm und hochherrschaftlich. Da war keins, das nicht einen Giebel gehabt hätte, keins ohne Erker und ohne spitzige Türmchen und Dachreiter.
Etwelche waren ganz aus roten Ziegelsteinen ausgeführt, wie nordische Kirchen; und andere daneben schienen wieder nur aus Orgelpfeifen zusammengebunden zu sein. Und die Eckhäuser bekrönten stolze, hohe, vielseitig gerundete Kuppeln, Riesentintenfässer mit reichlichem Gold. Oder riesige Fußbälle lagen da plötzlich auf dem Dach. So vornehm und hochherrschaftlich war die Straße.
Und sie hatte etwa keine Gasbeleuchtung mehr, sondern hoch oben, an scharfgespannten Drähten, schwebten die riesigen Calvillen der Bogenlampen, mitten über dem Damm, hoch über dem niederen Netzwerk der Straßenbahnleitungen, ja fast über den vier Reihen von Ulmen und Linden, die, immer, immer kleiner werdend, rechts und links, soweit man nur sehen konnte, sich die Straße hinabzogen.
Auf dem Bürgersteig aber zeichneten sich im Winter und im ersten Frühjahr ganz fein, scharf und genau, die Schatten aller Äste, Zweige und Zweiglein ab. Später, im Frühling, Sommer und Herbst aber, wenn das Laub an den Bäumen war, ging man hier des Abends in einem schönen, mattgrünen Halblicht dahin, das sich nach den Häusern und Torwegen, sobald die Läden geschlossen waren und ihr Licht eingestellt hatten, in ein für die dort plaudernden Paare höchst angenehmes und schützendes Dunkel verwandelte.
Wer sollte zweifeln, dass es eine hochherrschaftliche Straße war”
Georg Hermann war einer der bedeutendsten Schriftsteller Berlins. 1906 hat er mit seinem bekanntesten Roman “Jettchen Gebert” das jüdische Bürgertum im biedermeierlichen Berlin portraitiert. Was die Menschen damals so gerührt hat und dem Roman zu einem großen Erfolg verholfen hat, war die unglückliche Liebe der Protagonistin. Heute begeistern uns vor allem die wunderbaren Milieuschilderungen und die liebevollen Städteportraits von Berlin und Charlottenburg. Onkel Salomon, der geschäftstüchtige Vorstand der standesbewussten jüdischen Familie, schickt 1839 die Seinen während der warmen Jahreszeit in die Charlottenburger Sommerfrische.1
Georg Hermann wurde 1871 in Berlin als Sohn eines verarmten jüdischen Kaufmannes geboren. Er studierte in Berlin Kunstgeschichte und arbeitete als Kunstkritiker und Journalist. Nach einigen Jahren in Neckargemünd bei Heidelberg kehrte er 1931 wieder nach Berlin zurück, wo er in die Wilmersdorfer Künstlerkolonie zog. Von hier aus floh er 1933 mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Holland. Nach der Besetzung der Niederlande durch deutsche Truppen wurde der 72jährige, herz- und zuckerkranke Schriftsteller verhaftet, ins KZ Westerbork eingeliefert und am 16.11.1943 von dort nach Auschwitz deportiert. Dort wurde er in der Gaskammer ermordet, wahrscheinlich am 19. November 1943.
Südwestkorso (rechts)
Laubenheimer Straße (links)
Kreuznacher Straße (rechts)
( Kreuznacher Str. 28 Gedenktafel für Georg Hermann
In dem hier vormals stehenden Wohnhaus Nr. 2
lebte von 1931bis zu seiner Emigration im Jahre 1933
GEORG HERMANN
7.10.1871 – 19.11.1943
Schriftsteller, schilderte in den Romanen “Jettchen Gebert” (1906),
“Henriette Jacoby” (1908), “Kubinke” (1910) und anderen
Werken das Leben in Berlin Charlottenburg, Schöneberg und
Wilmersdorf.
Wurde im KZ Auschwitz- Birkenau ermordet.)
Bonner Straße (rechts)
Bonner Str.2 Gedenktafel für Helene Jacobs
In diesem Haus lebte von 1935 bis zu ihrem Tode
die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
HELENE JACOBS
25.02.1906 – 13.08.1993
Sie versteckte in ihrer Wohnung untergetauchte Juden und
verhalf ihnen zur Flucht. Sie wurde von der Nazi-Justiz
zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.
Berlin, im April 1997
Ludwig-Barney-Platz: Künstlerkolonie
Der Platz wurde 1963 benannt nach dem Schauspieler und Theaterleiter Ludwig Barnay (1842-1924). Er war Mitbegründer des Deutschen Theaters und der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Bis 1963 hieß der Platz Laubenheimer Platz.
Rund um den Platz wurde von 1927 bis 1930 in mehreren Baustufen die Künstlerkolonie errichtet. Bauherren waren die Bühnengenossenschaft und der Schutzverband deutscher Schriftsteller. Hier sollte es günstige Wohnungen geben für Bühnenkünstler, Schriftsteller und Journalisten. Entstanden sind in schlichter Ziegelbauweise vier- bis fünfgeschossige, um großzügige Höfe gruppierte Blöcke, überwiegend rot verklinkert, teilweise mit expressionistischen Schmuckelementen. Die Wohnungen waren klein und preiswert, aber durchaus komfortabel und beliebt bei Künstlern, Schauspielern, Sängern, Tänzern und Schriftstellern, die wenig verdienten.
Wegen der überwiegend “linken” Gesinnung ihrer Bewohner wurde die Künstlerkolonie in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren als “Roter Block” populär. Am 15.03.1933 gab es eine NS-Großrazzia, es war eine der ersten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Auf dem damaligen Laubenheimer Platz brannten die Bücher der Bewohnerinnen und Bewohner.
Alexander Graf Stenbock-Fermor hat in seiner Autobiographie diese Razzia beschrieben:
“Schon bald – in der Morgendämmerung – wurde die ganze Künstlerkolonie von Hilfspolizei umstellt. Es waren SA-Männer, die blaue Polizeimäntel mit weißen Armbinden über ihren braunen Hemden und Stiefelhosen trugen. Die ‘Polizisten’ hielten Karabiner im Anschlag. Als ich das Fenster öffnete, zielte einer auf mich…
Auf dem Laubenheimer Platz, mitten in der Künstlerkolonie, brannte ein großes Feuer, in das SA-Männer einige der wertvollen gestohlenen Bücher warfen. Ein Mob umtanzte gröhlend das Feuer. Auf den Straßen am Platz warteten Lastwagen, die mimt ganzen Bibliotheken und Möbeln beladen waren. Auf einem der Wagen standen die Verhafteten zusammengepfercht: Jüdische und ‘arische’ Interllektuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten, Parteilose. SA-Leute richteten ihre Karabiner auf sie. Als der Wagen anfuhr, mussten die Gefangenen mit erhobenen Händen das Horst-Wessel-Lied singen.”
1988 wurde auf der Rasenfläche des Platzes der Gedenkstein enthüllt, ein Findling mit einer Bronzetafel mit der Inschrift: “Mahnmal für die politisch Verfolgten der Künstlerkolonie”. Der Gedenkstein wurde aufgestellt auf Initiative des Vereins KünstlerKolonie e.V. unter dem Vorsitzenden Holger Münzer.
Hier wohnten unter anderem Johannes R. Becher, Ernst Bloch, Ernst Busch, Axel Eggebrecht, Walter Hasenclever, Georg Hermann, Peter Huchel, Helene Jacobs, Alfred Kantorowicz, Arthur Koestler, Susanne Leonhardt, Manès Sperber, Erich Weinert und Walter Zadek, der Vater des berühmten Theaterregisseurs Peter Zadek.
Südwestkorso (rechts)
Rheingau-Viertel, Georg Haberland
Das “rheinische Viertel” wurde um 1910 geplant und begonnen von Georg Haberland als “Gartenstadt Wilmersdorf”, weitergeführt in den 20er Jahren. Die Wohnsiedlung gilt als vorbildliche Frühform aufgelockerter Bauweise im Grünen.
Der U-Bahnhof wurde 1913 eröffnet. Georg Haberland hatte lange für den Bau der U-Bahn gekämpft. Die Stadt Charlottenburg fürchtete eine Abwanderung gut zahlender Steuerbürger nach Wilmersdorf. Schließlich konnte Haberland die U-Bahn-Linie als Luxus-U-Bahn zur Erschließung des “Rheingau”-Viertels bauen lassen.
Georg Haberland wurde 1861 in Wittstock an der Dosse geboren. Er wurde Direktor der Berlinischen Bodengesellschaft, die sein Vater Salomon Haberland gegründet hatte. Neben dem Rheingauviertel gehen auch das Bayerische Viertel und die Bebauung des Tempelhofer Feldes auf seine Initiative zurück. Georg Haberland war “Baulöwe”, Direktor der Terrain-Gesellschaft Berlin-Südwest, Mitglied der Wilmersdorfer Gemeindeverwaltung und seit 1910 Berliner Stadtverordneter. Er gründete den Schutzverband für Deutschen Grundbesitz und war Mitglied der Industrie- und Handelskammer. Er starb 1933 in Berlin und ist auf dem Jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg begraben.
Wiesbadener Straße (links)
Rüdesheimer Platz
Breite Straße
Berkaer Straße
Berkaer Platz: Rathaus Schmargendorf
Das 1900-02 von Otto Kerwien im Stil der märkischen Backsteingotik mit Jugendstilelementen erbaute Rathaus Schmargendorf wurde als Standesamt genutzt, nachdem Schmargendorf 1920 in den Bezirk Wilmersdorf eingegliedert worden war. Viele Prominente heirateten hier. Einer der ersten war Albert Einstein, der nach der Scheidung von seiner Frau Mileva 1920 seine Cousine Elsa Löwenthal heiratete. Er wohnte damals in Schöneberg in der Haberlandstraße 5. Am Tag der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 befand Einstein sich auf einer Vortragsreise in den USA. Er legte alle seine Ämter in Deutschland nieder und siedelte in die USA über. Er wurde von den Nationalsozialisten ausgebürgert, und seine Bücher wurden verbrannt.
Berkaer Str. 31-34: Gedenktafel: ehemaliges jüdisches Altersheim
Die Gedenktafel an dem Haus Berkaer Straße 31-34 wurde am 9. November 1988 enthüllt:
Dieses Haus wurde 1930 von dem Architekten
Alexander Beer 10.9.1873 – 8.5.1944 als
ALTERSHEIM FÜR DIE JÜDISCHE GEMEINDE ZU BERLIN
erbaut. Es wurde 1941 von der SS beschlagnahmt, die letzten Bewohner
und das Pflegepersonal deportiert und im Konzentrationslager ermordet.
Alexander Beer wurde 1943 ins Konzentrationslager
Theresienstadt deportiert und dort am 8.5.1944 ermordet.
Franzensbader Straße (rechts)
Franzensbader Str. 7-8: Gedenktafel: ehemalige Synagoge Grunewald
An dem Haus Franzensbader Straße 7-8 wurde am 9. November 1988 eine Gedenktafel enthüllt:
An dieser Stelle stand einst
die Synagoge Grunewald
umgebaut von B. und O. Neubauer 1923
eingeweiht am 8. September 1923
angezündet und zerstört von
Nationalsozialisten am 9. November 1938
“Mögen von dem neuen Gotteshaus die
edelsten und nachhaltigsten Wirkungen auf die
ganze Gemeinde ausgehen”.
Grunewald-Echo 16.9.1923
In der Villenkolonie Grunewald lebten seit ihrer Gründung 1889 besonders viele wohlhabende Juden. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg hatten 20 Villenbesitzer den “Synagogenverein Grunewald” gegründet. Zunächst hielt er seine Gottesdienste in dem Haus des 1. Vorsitzenden in der damaligen Jagowstraße 34 ab, heute Richard-Strauss-Straße 34. In dem Haus Delbrückstraße 20, das heute zur Grunewald-Grundschule gehört, unterhielt der Verein eine Religionsschule. 1923 kaufte er dieses Grundstück mit dem Tanz- und Ausflugslokal “Franzensbader Garten”. Es war seit 1895 eines der vielen beliebten Grunewalder Ausflugsziele.
In dem ehemaligen Tanzsaal wurde die Synagoge eingerichtet, die 400 Plätze anbot. Im zweigeschossigen Hauptgebäude wurden Rabbiner-, Vereins-, und Sitzungsräume sowie Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss untergebracht. Das Gebäude im ländlichen Villenhausstil mit Fachwerk und Holzverzierung wurde bei den Umbauten äußerlich kaum verändert.
Bis zum November 1938 fanden hier regelmäßig Gottesdienste statt. In der Pogromnacht vom 9. zum 10. November wurde die Synagoge von Nationalsozialisten angezündet und brannte weitgehend aus.
In einem Vermerk des Wilmersdorfer Bauamtes von 1940 heißt es:
“Der Synagogenteil ist bis auf die stehengebliebenen Umfassungswände mit den hohen Fensteröffnungen völlig zerstört; die Holzkonstruktionen des Daches und der Decke sind verbrannt und ins Innere gestürzt. Von dem zweigeschossigen Bauteil ist ein Teil des Daches und des Bodenraumes vom Brand zerstört. Die Räume – Erdgeschoß und Wohnungen sind geräumt, sämtliche Fensterscheiben sind zerschlagen, die Fensterflügel fehlen. Das Grundstück steht unbenutzt. … Eine Wiederherstellung des Synagogenteils für gewerbliche Zwecke erscheint unwirtschaftlich, da höchstens ein Neuaufbau auf dem vorhandenen Fundament in Frage kommen dürfte. Die Brandruine wirkt stark störend auf das Straßenbild und stellt somit eine das Interesse der Allgemeinheit besonders schädigende Verunstaltung dar.”
1941 wurde die Synagoge abgerissen. In den 50er Jahren wurde auf dem Grundstück ein Wohngebäude errichtet.
Die Firma Wall hat 2003 die Bushaltestelle als Gedenkort mit einer entsprechenden Information eingerichtet.
Delbrückstraße (links)
Hubertusallee (links)
Joseph-Joachim-Platz
Teplitzer Straße
Hagenstraße (rechts)
Hagenstr. 56: Jüdische Schule am Roseneck von Toni Lessler
Die 1874 in Bückeberg geborene Pädagogin Toni Lessler hatte bereits 1912 in der Uhlandstraße einen Privatschulzirkel gegründet. 1930 eröffnete sie in der Brahmsstraße die “Private Waldschule Grunewald”, die schnell größer wurde, 1932 hierher an die Hagenstraße 56 umzog und in “Schule am Roseneck” umbenannt wurde. Nach 1933 mussten sogenannte “arische” Schülerinnen und Schüler diese Schule verlassen. Sie erhielt immer stärkeren Zulauf von jüdischen Schülerinnen und Schülern, die nur noch eine jüdische Schule besuchen durften. 1939 wurde die Schule geschlossen, und Toni Lessler emigrierte in letzter Minute in die USA. 1953 starb sie in New York.
(Lion Feuchtwanger
Lion und Marta Feuchtwanger lebten von 1930 bis 1932 in der damaligen Mahlerstraße 8, heute Regerstraße 8. Lion Feuchtwanger war einer der erfolgreichsten und populärsten Schriftsteller der Weimarer Republik. Er hatte seit Hitlers Aufstieg vor den Nationalsozialisten gewarnt.
Alfred Kantorowicz berichtet von einem Treffen mit Feuchtwanger 1930, wo er sagte, Berlin sei
“eine Stadt voll von künftigen Emigranten; sodann ging er mit viel Eifer daran, eine Villa im Grunewald zu erwerben und sie für sich, seine Frau Marta und seine zahlreichen kostbaren Bücher einzurichten als Heimstätte für Lebenszeit. Wenn man ihn aber später im Exil daran erinnerte, so kam ein Lächeln in seine klugen Augen hinter den dicken Brillengläsern und über sein runzeliges Eulengesicht, und mit einem fast unhörbaren, nach innen gekehrten Glucksen antwortete er: ‘Was wollen Sie – so ist der Mensch’.”
1935 schreibt er im Pariser Exil den Emigrationsroman “Die Geschwister Oppermann”:
“Gustav Oppermann, wie jeden Morgen, freute sich seines Hauses. Wer, wenn er unvorbereitet hierher versetzt wurde, konnte ahnen, daß er nur fünf Kilometer von der Gedächtniskirche entfernt war, dem Zentrum des Berliner Westens? Wirklich, er hat sich für sein Haus den schönsten Fleck Berlins ausgesucht. Hier hat er jeden nur wünschbaren ländlichen Frieden und dennoch alle Vorteile der großen Stadt. …
Eine heiße Wut überkam ihn, daß man ihn zwingen wollte, sein Haus zu verlassen, seine Arbeit, seine Menschen, diese Heimat, zehnmal mehr seine Heimat als die derjenigen, die ihn zwangen. Um diese Zeit ist der Grunewald am schönsten. Eine Schweinerei, ihn jetzt verlassen zu müssen.”
Am 20.3.1935 veröffentliche Lion Feuchtwanger im Pariser Tageblatt einen bitter sarkastischen “Offenen Brief an die Bewohner meines Hauses Mahlerstraße 8 in Berlin”:
“Ich weiß nicht, wie Sie heißen, mein Herr, und auf welche Art Sie in den Besitz meines Hauses gelangt sind …
Wie gefällt Ihnen mein Haus, Herr X? Lebt es sich angenehm darin? Hat der silbergraue Teppichbelag der oberen Räume bei der Plünderung durch die SA-Leute sehr gelitten? …
Was fangen Sie wohl mit den beiden Räumen an, die meine Bibliothek enthielten? Bücher, habe ich mir sagen lassen, sind nicht sehr beliebt in dem Reich, indem Sie leben, Herr X, und wer sich damit befaßt, gerät leicht in Unannehmlichkeiten. Ich zum Beispiel habe das Buch Ihres Führers gelesen und harmlos konstatiert, daß seine 140.000 Worte 140.000 Verstöße gegen den deutschen Sprachgeist sind. Infolge dieser meiner Feststellung sitzen jetzt Sie in meinem Haus. …
Lassen Sie mein Haus nicht verkommen, Herr X … Pflegen Sie es, bitte, ein bißchen. … Ihr “Führer” hat versprochen, daß seine Herrschaft tausend Jahre dauern wird: ich nehme an, Sie werden bald in der Lage sein, sich mit mir über die Rückgabe des Hauses auseinanderzusetzen.”)
Richard-Strauss-Straße (rechts)
Richard-Strauss-Str. 35
Vera Lachmann Schule (1933-38, damals Jagowstr. 35)
Die 1904 in Berlin geborene Vera Lachmann besuchte die “Fürstin-Bismarck-Schule” in Charlottenburg, studierte Germanistik und Altphilologie in Basel und Berlin und promovierte 1931 in Berlin. Im Februar 1933 machte sie das Staatsexamen für das Lehramt an höheren Schulen und gründete im April hier in diesem Haus gemeinsam mit Dr. Helene Herrmann eine kleine Privatschule für “nicht-arische” Kinder in Grunewald. Ende 1938 wurde die Schule geschlossen. Dr. Vera Lachmann war einige Monate für die Kinderauswanderungsabteilung der “Reichsvertretung der Juden in Deutschland tätig, bevor sie Ende 1939 über Dänemark und Schweden in die USA emigrierte, wo sie 1946 die amerikanische Staatsangehörigkeit erhielt, 1972 am Brooklyn College in New York eine Professur antrat und 1985 in New York starb.
Richard-Strauss-Str. 34 (gegenüber)
Hier lebte in den 20er Jahren Willy Abramczyk, der Vorsitzende des “Synagogenvereins Grunewald”. Bei ihm wurden die Gottesdienste des Vereins abgehalten, bis 1923 die Synagoge in der Franzensbader Straße eingeweiht wurde.
Richard-Strauss-Str. 22: Gedenktafel für Max Alsberg
Hier lebte von 1925 bis 1933
Max Alsberg
16.10.1877 – 12.9.1933
Der Jurist und Schriftsteller wirkte als Strafrechtsreformer und Anwalt
in vielen aufsehenerregenden Prozessen.
Wegen der Verfolgung und des Boykotts jüdischer Rechtsanwälte
emigrierte er 1933 in die Schweiz wo er sich das Leben nahm.
Toni-Lessler-Straße (links)
Diese Straße wurde 1936 benannt nach dem Theologen Reinhold Seeberg. Zuvor hieß die Straße von 1898 bis 1936 Dunckerstraße nach dem Buchhändler und Politiker Franz Günter Duncker. Er war seit 1867 Reichstagsabgeordneter der Fortschrittspartei und gründete 1869 gemeinsam mit Max Hirsch die “Hirsch-Dunckerschen Deutschen Gewerkvereine” als liberale Gegenbewegung gegen die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften. Die Nationalsozialisten wollten den vermutlich jüdischen Namen aus dem Straßenbild auslöschen und ersetzten ihn durch den Theologen Reinhold Seeberg, der als Experte auf dem Gebiet der Dogmengeschichte galt. Er ist heute äußerst umstritten, hat in einigen Schriften den Krieg verherrlicht, sich antisemitisch geäußert und kurz vor seinem Tod 1935 die Machübernahme der Nationalsozialisten begrüßt.
Bereits 1982 hat die Fraktion der FDP in der Wilmersdorfer BVV beantragt, eine Liste der Straßen vorzulegen, die in der Nazizeit umbenannt wurden, und diese Umbenennungen möglichst rückgängig zu machen. Seither wurde jahrelang auch über eine Umbenennung des Seebergsteigs diskutiert. Schließlich konnte das Bezirksamt am 1. September 2003 endlich den früheren Seebergsteig in Toni-Lessler-Straße umbenennen – trotz starker Proteste von Anwohnern.
Toni-Lessler-Str. 2: Gedenktafel für Joachim Gottschalk
Hier lebte bis 1941
Joachim Gottschalk
10.4.1904 – 6.11.1941
Bühnen- und Filmschauspieler
Nahm sich wegen
zunehmender Repressionen der Nationalsozialisten
gegen seine jüdische Frau Meta gemeinsam
mit ihr und seinem Sohn Michael das Leben
Die Gedenktafel wurde am 6. November 2000 hier in Pultform auf dem Gehweg enthüllt, weil der Hausbesitzer sich weigerte, die Tafel an seinem Haus oder am Zaun anbringen zu lassen. Er meinte, dass das Holocaust-Mahnmal am Brandenburger Tor ausreichend sei.
Joachim Gottschalk war einer der bekanntesten deutschen Schauspieler der 30er Jahre. Er galt als “Clark Gable der Ufa”. Im Gegensatz zu anderen weigerte er sich standhaft, sich seiner jüdischen Frau Meta scheiden zu lassen. Auf persönliche Anweisung von Goebbels’ sollte sie nach Theresienstadt deportiert werden, weil Goebbels erst im Nachhinein erfahren hatte, dass er ihr, einer Jüdin, bei der Premierenfeier für den Film “Die schwedische Nachtigall” die Hand geküsst hatte. Da Goebbels Gottschalks Bitte ablehnte, mit ins Lager gehen zu dürfen, vergiftete er sich gemeinsam mit ihr und dem Sohn Michael. Das Grab der Familie auf dem Südwest-Friedhof in Stahnsdorf wurde 1999 vom Berliner Senat zum Ehrengrab erklärt. Der Regisseur Kurt Maetzig hat 1947 für die DEFA das Schicksal der Familie Gottschalk unter dem Titel “Ehe im Schatten” verfilmt.
Wernerstraße (rechts)
Bismarckallee (links)
Koenigsallee (links)
Carl Fürstenberg
Hier lebte hier von 1898 bis zu seinem Tod 1933 Carl Fürstenberg, Bankier und Direktor der Berliner Handelsgesellschaft. Er beteiligte seine Bank am Ausbau des Kurfürstendamms und an der Erschließung der Villenkolonie Grunewald. Seine Frau Aniela war berühmt für ihre Tischordnungen bei den Soireen in dem riesigen Palais. Zu Gast waren Walter Leistikow, Hanns Fechner, Max Klein, Walther Rathenau, Maximilian Harden, Alfred Kerr, Richard Strauss, Gerhart Hauptmann, May Reinhardt und viele andere. Sein riesiges Grundstück reichte bis zum Dianasee. Es wurde in der Nachkriegszeit mit Reihenhäusern bebaut.
Fontanestraße (rechts)
(Douglasstr. Gedenktafel für Alfred Kerr
Hier lebte bis zu seiner Emigration
im Jahre 1933
ALFRED KERR
Theaterkritiker, Schriftsteller und Dichter
*25.12.1867 +2.10.1948
Breslau Hamburg
Er lebte hier von 1929 bis 1933. Er war Schriftsteller und der wichtigste Theaterkritiker in Berlin bis 1933. Kerr warnte schon in den 20er Jahren in seinen “Tagesglossen” im Rundfunk vor dem Nationalsozialismus. Er propagierte ein linkes Aktionsbündnis. Nach seiner Überzeugung hatten nur Kommunisten und Sozialisten gemeinsam eine Chance, die Übernahme der Macht durch die Nazis zu verhindern. Er stand für Nationalsozialisten ganz oben auf der schwarzen Liste.
Seine Tochter Judith Kerr beschrieb in ihrem Buch “Als Hitler mein rosa Kaninchen stahl” die Emigration der Familie. Im ersten Kapitel unterhält sie sich mit ihrer Schulfreundin, mit der sie gemeinsam die Grunewald-Grundschule besuchte:
“Ich dachte, Juden hätten krumme Nasen, aber deine Nase ist ganz normal. Hat dein Bruder eine krumme Nase?”
“Nein”, sagte Anna, “der einzige Mensch in unserem Haus mit einer krummen Nase ist unser Mädchen Bertha, und deren Nase ist krumm, weil sie aus der Straßenbahn gestürzt ist und sie sich gebrochen hat.” Esbeth wurde ärgerlich. “Aber dann”, sagte sie, “wenn du wie alle anderen aussiehst und nicht in eine besondere Kirche gehst, wie kannst du dann wissen, daß du wirklich jüdisch bist? Wie kannst du sicher sein?”
Aus der kindlichen Perspektive beschreibt Judith Kerr die überstürzte Flucht des Vaters im Februar 1933, dem die Familie bald folgte:
“Warum ist Papa so plötzlich weggefahren?”
“Weil ihn gestern jemand angerufen und ihn gewarnt hat, daß man ihm vielleicht den Paß wegnehmen würde. Darum habe ich ihm einen kleinen Koffer gepackt, und er hat den Nachtzug nach Prag genommen – das ist der kürzeste Weg aus Deutschland hinaus.”
“Wer könnte ihm denn seinen Paß wegnehmen?”
“Die Polizei. In der Polizei gibt es ziemlich viele Nazis.”
“Und wer hat ihn angerufen und ihn gewarnt?”
Mama lächelte zum ersten Mal.
“Auch ein Polizist. Einer, den Papa nie getroffen hat; einer, der seine Bücher gelesen hat, und dem sie gefallen haben.”
Kerrs Sohn Michael (1921 in Berlin geboren) wurde als Sir Michael Kerr oberster Richter in Großbritannien.)
( Bettinastr. 4: Gedenktafel für Hans Ullstein
Hier lebte von 1913 bis 1935
Hans Ullstein
18.1.1859 – 14.5.1935
Verleger, leitete mit seinen Brüdern
Hermann, Louis, Franz und Rudolf den vom Vater Leopold
gegründeten Ullstein-Verlag.
Nach 1933 vertrieben die Nationalsozialisten die Verlegerfamilie aus Deutschland und beraubten sie ihres Vermögens.
Fontanestr. 8: Gedenktafel für Max Reinhardt
Hier lebte von 1902 bis 1905
Marx Reinhardt
9.9.1873 – 31.10.1943
Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
Schöpfer des modernen Regietheaters
Der Intendant bedeutender Sprechbühnen Berlins
und Gründer zahlreicher Theater dieser Stadt
verließ 1933 Deutschland und emigrierte später
in die USA
Bahnhof Grunewald: Gedenkstätten
Dieser Bahnhof wurde 1879 zunächst als Bahnhof Hundekehle eröffnet, 1884 wurde er umbenannt in “Bahnhof Grunewald”. Zunächst wurde er vor allem von den Grunewald-Ausflüglern aus Berlin genutzt, seit der Zeit um 1900 zunehmend auch von den Bewohnern der Villenkolonie. Das Bahnhofsgebäude wurde 1899 von Karl Cornelius gebaut. Es steht ebenso unter Denkmalschutz wie der Tunnel (1884-85), Bahnsteig 1 (1885) und Bahnsteig 2 (1935)
Seit dem 18. Oktober 1941 fuhren von hier und von den Bahnhöfen Putlitzstraße und Lehrter Stadtbahnhof Deportationszüge nach Lodz, Riga und Auschwitz und brachten insgesamt mehr als 50.000 jüdische Berlinerinnen und Berliner in die Vernichtungslager, wo die meisten von ihnen ermordet wurden.
Auf Initiative der Bezirksverordnetenversammlung Wilmersdorf wurde am 18. Oktober 1991 das Mahnmal von Karol Broniatowski enthüllt. Es zeigt Negativabdrücke von menschlichen Gestalten in einem Betonblock und informiert daneben auf einer Bronzetafel über die Deportationen. Der Text lautet:
Zum Gedenken
an die mehr als 50.000 Juden Berlins, die zwischen Oktober 1941 und Februar 1945 vorwiegend vom Güterbahnhof Grunewald aus durch den nationalsozialistischen Staat in seine Vernichtungslager deportiert und ermordet wurden. Zur Mahnung an uns, jeder Mißachtung des Lebens und der Würde des Menschen mutig und ohne Zögern entgegenzutreten.
Auch die Deutsche Bahn AG hat sich für die Erinnerung an die Deportationen von diesem Bahnhof engagiert. Am 27. Januar 1998 wurde das Mahnmal auf der Gleisanlage von der Deutschen Bahn AG enthüllt. Wir wollen uns jetzt dieses Mahnmal der Deutschen Bahn näher anschauen.
Mahnmal der Deutschen Bahn AG
Das Mahnmal der Deutschen Bahn AG wurde von Nicolaus Hirsch, Wolfgang Lorch und Andrea Wandel geschaffen. Es befindet sich an den Gleisen, von denen die Deportationszüge abgefahren sind. Es besteht aus Metallplatten auf den ehemaligen Verladebahnsteigen. Auf diesen Metallplatten sind die Daten, Bestimmungsorte und die Opferzahlen der einzelnen Transporte eingraviert. Wir kennen diese Daten aus den Transportlisten der Nationalsozialisten.
Sie haben genaue Listen über die Transporte geführt, auf denen allerdings die Verladebahnhöfe nicht erwähnt sind. Deshalb wissen wir nur von Augenzeugenberichten über einzelne Transporte vom Bahnhof Grunewald. Die großen Transporte mit meist mehr als 1000 Menschen gingen zunächst nach Lodz und Riga, seit Ende 1942 bis Juni 1943 nach Auschwitz. Danach gab es noch bis zum 2.2.1945 kleinere Transporte, zuletzt am 2.2.1945 mit 11 Opfern nach Ravensbrück.
Die Reichsbahn verlangte von der SS pro Person und gefahrenem Schienenkilometer 4 Pfennige, pro Kind 2 Pfennige, nur die Hälfte wenn mehr als 400 Menschen transportiert wurden. Für die ersten Transporte wurden noch Personenzüge verwendet, später Güterzüge.
Ein Reichsbahner hat beispielsweise folgendes berichtet:
“An einem Abend im Winter 1942/43, der sehr kalt war, kam Herr von der Heid vom Dienst nach Hause und berichtete völlig aufgelöst, daß von seinem Bahnsteig wieder ein Transport abgegangen sei … Er hatte das schon öfter erlebt … war aber froh, als er sah, daß bei dieser Kälte kleine Eisenöfen auf dem Bahnsteig zum Verladen bereitstanden … Die Waggons wurden immer voller mit Menschen ‘gepackt’ … Aber die Öfen wurden nicht verladen … Sie waren nur zur Schau angeliefert worden.”
Von den etwa 170.000 in Berlin lebenden Juden wurden 55.000 in Konzentrationslagern ermordet. Von 5000, die in den Untergrund gingen (wie z.B. Hans Rosenthal oder Inge Deutschkron) haben 1.400 überlebt.
Trabener Straße (links)
Erdener Straße (rechts)
Erdener Str. 8: Gedenktafel für Samuel Fischer
Das Relief zeigt ein Porträt von Samuel Fischer und das berühmte Verlagssignet, den Fischer mit dem Netz.
Der 1859 in Ungarn geborene Samuel Fischer lebte hier seit 1905 bis zu seinem Tod 1934. Er war der Verleger von Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Hermann Hesse, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler und vielen anderen deutschen Autoren. Ohne ihn wäre die deutsche Literatur zwischen 1900 und 1933 nicht denkbar.
Seine Tochter Brigitte Behrmann-Fischer schrieb ein Erinnerungsbuch unter dem Titel “Sie schrieben mir – oder Was aus meinem Poesiealbum wurde”. Es ist eines der schönsten Dokumente der Villenkolonie Grunewald als kulturelles Zentrum. Brigitte Behrmann-Fischer schreibt:
“‘Leute’ kamen oft und viele in mein Elternhaus, in die schöne und helle, weitläufige Villa im Grunewald. An ihrer Außenwand zeigte sie das S. Fischer-Signet, den Fischer mit dem Netz, als Relief …”
Brigitte Behrmann-Fischer beschreibt Treffen mit den Berliner Philharmonikern und mit Albert Einstein, der für jedes Streitgespräch offen war aber äußerst empfindlich reagierte, wenn sein Geigenspiel nicht genügend gewürdigt wurde.
Felix Salten, Freund der Familie, schrieb 1910 in “Spaziergang in Berlin”:
“Es hat einen unvergleichlichen Reiz, als bummelnder oder als geschäftiger Fremder in der Stadt drin zu wohnen, umherzulaufen, sich umklirren und umdröhnen zu lassen von dem siedenden Tumult dieses Lebens, dann aber mit einem Automobil blitzschnell hinauszurasen, zu dem Haus im Grunewald und dort still zu sitzen. Es ist, wie wenn man unter dem Wasser geschwommen wäre, bis es einem in den Ohren braust, bis einem die Schläfen hämmern und ein eherner Druck einem die Brust umpreßt. Dann aber taucht man auf, und die Luft streicht einem beschwichtigend über die Wangen, und man hat das himmlische Glück der tiefen Atemzüge.”
Nach 1945 zog Hans Werner Richter in das Haus und organisierte hier Treffen der Gruppe 47, später richtete sich hier das Literarisches Colloquium ein, bevor es nach Wannsee zog. Heute ist das Haus in Privatbesitz.
Koenigsallee (links)
Gedenkstein für Walther Rathenau
Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands
Dem Andenken an
WALTHER RATHENAU
Reichsaußenminister der deutschen Republik
Er fiel an dieser Stelle durch Mörderhand
am 24. Juni 1922
Die Gesundheit eines Volkes
kommt nur aus seinem inneren Leben
Aus dem Leben seiner Seele und seines Geistes
Oktober 1946
Walther Rathenau (1867-1922) übernahm als Sohn des AEG-Gründers Emil Rathenau als Direktor die Leitung der AEG. Daneben schrieb er philosophische und essayistische Werke. Besonders umstritten war 1896 seine Streitschrift “Höre Israel”, in der er den deutschen Juden die vollständige Assimilation empfiehlt. Er war politisch in der liberalen Deutschen Demokratischen Partei DDP aktiv, organisierte im Ersten Weltkrieg den Nachschub für das Heer und wurde am 1.2.1921 Reichsaußenminister. Seine Politik der Aussöhnung mit Russland im Rapallo-Vertrag machte ihm Feinde über die antisemitischen Gegener hinaus. Obwohl er wusste, dass er extrem gefährdet war, lehnte er verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für seine Person ab.
Am 24. Juni 1922 wurde er auf dem Weg von seinem Haus in der Koenigsallee 65 ins Außenministerium hier in der Koenigsallee Ecke Erdener Straße im offenen Wagen ermordet. Die Attentäter überholten sein Auto in der Kurve, schossen auf ihn und warfen eine Handgranate in seinen Wagen. Blutüberströmt wurde er in sein Haus zurückgebracht, wo er kurz danach starb.
Seit 1990 geht von diesem Gedenkstein jährlich am 9. November ein von Schülern gemeinsam mit dem Bezirksamt organisierter Gedenkmarsch zum Bahnhof Grunewald.
Hubertusallee (links)
Rathenauplatz
Kurfürstendamm
Henriettenplatz
Markgraf-Albrecht-Straße (links)
Markgraf-Albrecht-Straße 11-12: Gedenktafel: ehemalige Synagoge “Friedenstempel” Halensee
Hier wurde am 9. November 1988 eine Gedenktafel enthüllt, die an die früher hier stehende Synagoge erinnert. Sie ist auf der Bronzetafel als Relief abgebildet. Daneben enthält die Tafel folgenden Text:
An dieser Stelle stand einst
die Synagoge “Friedenstempel”
erbaut von G. und C. Gause 1922-1923
eingeweiht am 9.September 1923
angezündet und zerstört von
Nationalsozialisten am 9.November 1938
“Der Tempel soll nicht allein religiösen
Zwecken dienen, sondern auch eine Versamm-
lungsstätte aller sein, die an der Herbeiführung
eines wirklichen Friedens mitarbeiten wollen”.
Prof. Dr.S. Goldberg anläßlich der Einweihung
Die Synagoge bot Platz für 1450 Menschen und war damit eine der großen Berliner Vereinssynagogen. Sie war gestiftet worden von dem Besitzer des Lunaparks, Prof. Dr. jur. Salomon Goldberg. Er erwarb 1922 das als Acker ausgewiesene Grundstück. Es wurde eine Vereinssynagoge nach liberalem Ritus. 1929 wurde sie von der Berliner Jüdischen Gemeinde erworben. Sie wurde damit zur Gemeindesynagoge. Nach 1933 erlebte sie einen Aufschwung, weil immer mehr Juden, die von den Nationalsozialisten terrorisiert wurden, hier die Gemeinschaft suchten. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannte auch diese Synagoge.
Wie die Ruine der Synagoge in der Fasanenstraße wurde auch diese Ruine 1959 abgerissen und an ihrer Stelle das heutige Wohnhaus gebaut, ähnlich wie in der Prinzregentenstraße 69-70 und in der Franzensbader Str. 7-8.
Rabbiner Max Nussbaum, der noch 1940 emigrieren konnte und später in Hollywood amtierte, berichtete, dass ihn der US-amerikanische Journalist Louis P. Lochner (1887-1975), der damals Berliner Bürochef der Associated Press AP war, über die Ausschreitungen der Nacht vom 9. November in Kenntnis setzte. Er “informierte mich in den frühen Morgenstunden über das Brennen der Synagogen. Wir trafen uns sofort noch in der Dunkelheit auf der Straße und gingen zu der ‘Friedenstempel’ genannten Synagoge im Westen Berlins. Die Synagoge brannte, Feuerwehr stand da, aber beschränkte sich auf den Schutz der Nachbargebäude. Unser Chasan stand neben der brennenden Synagoge und führte mich heimlich durch eine Hintertür in das Innere. Der Aron-Kodesch war schon offen, Thorarollen herausgerissen und mit Anwendung größter Kraft zerrissen, die Hälfte der Bänke waren zerhackt. Ich trat ungesehen hinter den Thoraschrank und konnte mit einem Armgriff eine ganz kleine Thorarolle, die noch drin war, herausziehen und unter meinen Regenmantel verstecken, wir gingen wieder hinaus … Ich konnte die kleine Thorarolle zu mir nach Hause nehmen.”
Damaschkestraße (rechts)
Lehniner Platz: Erich-Mendelsohn-Baukomplex
Dieses Grundstück blieb als einziges am Kurfürstendamm noch bis in die 20er Jahre hinein unbebaut. Hier fanden am Anfang des 20. Jahrhunderts noch Flottenspiele statt, in einer Art Wasserzirkus mit Tribünen für 4.000 Besucher. 1905 wurden “Die letzten Tage von Pompeji” vorgeführt, 1908 Tennisplätze angelegt, im Winter eine Eisbahn, bis der Verleger Rudolf-Mosse das Gelände kaufte und 1927 von Erich Mendelsohn bebauen ließ. Die Mendelsohnschen Bauten wurden damals als sensationell empfunden. Hier entstand ein moderner Gebäudekomplex, der sich deutlich von den wilhelminischen Prachtbauten abhebt, die bis dahin am Kurfürstendamm entstanden waren. Mendelsohn schloss die vorhandene Baulücke im Grunde nicht, sondern er schuf eine Öffnung in der Reihe der geschlossenen wilhelminischen Fassaden. Wie “ein groß aufgesperrtes Maul” wirkte der Eingangsbereich, wie damals ein Kritiker meinte.
Die gesamte Anlage wurde in den 20er Jahren als revolutionär empfunden und von der Architekturkritik begeistert gefeiert. Mendelsohn baute das “Universum-Kino”, gegenüber das Kabarett der Komiker und einen Wohnkomplex entlang der Cicerostraße mit Tennisplätzen im hinteren Bereich.
Im Haus des KadeKo wurde das Café Leon eingerichtet. Es wurde zum Stammcafé von Erich Kästner, der 1931 von der Prager Straße hierher in die Roscherstraße gezogen war. Das KadeKo war eines der berühmtesten Kabaretts der 20er Jahre, in dem auch noch in den 30er Jahren gewagte Anspielungen gemacht wurden. Werner Finck zum Beispiel fragte noch im Jahr 1936 von der Bühne herunter den anwesenden Spitzel im Publikum: “Kommen Sie noch mit – oder muss ich mitkommen?”. In einem berühmten Sketch “Beim Schneider” interpretierte er den Hitlergruß als “Aufgehobene Rechte”. Seit dem 1.6.1945 spielte das Kabarett der Komiker im “Café Leon” ein Notprogramm. Im April 1948 eröffnete in seinen Räumen das “British Centre” mit Film-Club und Musik-Club.
Das “Universum-Kino” wurde nach 1945 zunächst als “Capitol”, später bis 1973 als “Studio” weiterbetrieben. In dem Bau residierte nach dem Krieg das Prominentenlokal Ricci. Nach Totalabriss und äußerlich originalgetreuem Wiederaufbau seit 1978 durch Jürgen Sawade wurde das Haus 1981 als Schaubühne am Lehniner Platz eröffnet.
Der Architekt Erich Mendelsohn hatte 1920 den Einstein-Turm für das Astrophysikalische Institut in Potsdam gebaut. Er gilt als eines der wichtigsten Beispiele expressionistischer Baukunst. 1930 baute er für sich selbst ein Wohnhaus in Charlottenburg Am Rupenhorn, wo er aber nur noch 3 Jahre leben konnte. 1933 emigrierte er über die Niederlande nach London und führte ab 1934 ein Architekturbüro in Jerusalem. 1941 wanderte er in die USA aus.
Kurfürstendamm
Erich Kästner erlebte die Nacht vom 9. zum 10. November 1938 auf dem Kurfürstendamm. Er hat darüber geschrieben:
“In jener Nacht fuhr ich, im Taxi auf dem Heimweg, den Tauentzien und Kurfürstendamm entlang. Auf beiden Straßenseiten standen Männer und schlugen mit Eisenstangen Schaufenster ein. Überall krachte und splitterte Glas. Es waren SS-Leute, in schwarzen Reithosen und hohen Stiefeln, aber in Ziviljacken und mit Hüten. Sie gingen gelassen und systematisch zu Werke. Jedem schienen vier, fünf Häuserfronten zugeteilt. Sie hoben die Stangen, schlugen mehrmals zu und rückten dann zum nächsten Schaufenster vor. Passanten waren nicht zu sehen. Erst später, hörte ich am folgenden Tag, seien Barfrauen, Nachtkellner und Straßenmädchen aufgetaucht und hätten die Auslagen geplündert.
Dreimal ließ ich das Taxi halten. Dreimal wollte ich aussteigen. Dreimal trat ein Kriminalbeamter hinter einem der Bäume hervor und forderte mich energisch auf, im Auto zu bleiben und weiterzufahren. Dreimal erklärte ich, dass ich doch wohl aussteigen könne, wann ich wolle, und das erst recht, wenn sich in aller Öffentlichkeit, gelinde ausgedrückt, Ungebührliches ereigne. Dreimal hieß es barsch: ‘Kriminalpolizei’! Dreimal wurde die Wagentür zugeschlagen. Dreimal fuhren wir weiter. Als ich zum vierten Mal halten wollte, weigerte sich der Chauffeuer. ‘Es hat keinen Zweck’, sagte er ‘und außerdem ist es Widerstand gegen die Staatsgewalt!’ Er bremste erst vor meiner Wohnung.”
Kästner wohnte von 1931 bis 1944 hier um die Ecke in der Roscherstraße 16
Adenauerplatz
Lewishamstraße (links)
Wilmersdorfer Straße (rechts)
( Sybelstr. 9: Gedenktafel für die Jüdische Private Musikschule Hollaender
Im Haus Sybelstraße 9 bestand von 1936 bis
1941 die Jüdische private Musikschule Hollaender.
Hier unterrichteten die jüdischen Lehrkräfte des
Stern’schen Konservatoriums Gustav Hollaender
nach dessen zwangsweiser Arisierung 1935. Ihre
Besitzer und Leiter
Kurt Hollaender (*1885) und
Susanne Landsberg (*1892)
geb. Hollaender
wurden, wie viele der hier Lehrenden, 1941/43
deportiert und ermordet.
Verein Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V. 8.11.1992
Der mörderische Antisemitismus der Nationalsozialisten war nicht nur ein Menschheitsverbrechen, sondern er war auch ein Zerstörungswerk an der deutschen Kultur. Eines der besonders eindrucksvollen Beispiele dafür ist das Sternsche Konservatorium der Musik. Dieses älteste Berliner Konservatorium war eine der bedeutendsten europäischen Musikschulen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es wurde 1850 als Musikschule für Gesang, Klavier und Komposition von Julius Stern, Adolf Bernhard Marx und Theodor Kullak gegründet. 1894 erwarb der Komponist, Dirigent und Geiger Gustav Hollaender das Institut und leitete es bis zu seinem Tod 1915. Unter seiner Leitung erlebte das Konservatorium eine Blütezeit. Es kam ohne jegliche Subvention aus. Es wurde von mehr als tausend Schülerinnen und Schüler pro Jahr besucht. Darunter befanden sich besonders zahlreiche Ausländer, die ihr Musikstudium in die Metropole Berlin führte, damals ein weltweit bekannter Umschlagplatz auf dem Gebiet
musikalischer Qualifikation. Das Konservatorium verdankte zwar seine Existenz privatem jüdischem Engagement, aber es stand allen offen, die sich musikalisch bilden wollten. Es war im besten Sinne universell, und es war eines der wertvollsten Aushängeschilder für Berlin und für ganz Deutschland. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wurde das Konservatorium gleichgeschaltet. Die jüdischen Inhaber wurden faktisch enteignet. Ihnen wurde verboten, nichtjüdische Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Sie konnten 1936 bis 1941 in der Sybelstraße 9 noch die Jüdische Musikschule Hollaender betreiben. Kurt Hollaender und Susanne Landsberg-Hollaender wurden deportiert und ermordet.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt das Städtische Konservatorium in West-Berlin den Namenszusatz “Ehemals Sternsches Konservatorium”. Heute ist das Julius-Stern-Institut für musikalische Nachwuchsförderung Teil der Universität der Künste. Der Name steht für eine große, bedeutende Tradition. Er steht für die deutsche Katastrophe, und er steht für einen Neuanfang, der die Geschichte nicht verdrängt.
Mommsenstraße (links)
(Unweit von hier lebte Mascha Kaléko. Sie veröffentlichte 1933 im Rowohlt Verlag ihr erstes Buch, “Das Lyrische Stenogrammheft”. 1935 folgte das “Kleine Lesebuch für Große”. Danach erhielt sie als jüdische Dichterin Schreibverbot und wurde aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Mit ihrem zweiten Mann, dem jüdischen Komponisten Chemjo Vinaver, und ihrem Sohn konnte sie 1938 gerade noch rechtzeitig aus Deutschland emigrieren. Zuletzt hatte die Familie in der Bleibtreustraße 10-11 unweit des Savignyplatzes gelebt, wo heute eine Gedenktafel an sie erinnert. In der von deutschen Emigranten in Amerika gegründeten Zeitung “Aufbau” veröffentlichte sie die Verse:
“Ich bin, vor jenen ‘tausend Jahren’
Viel in der Welt herumgefahren.
Schön war die Fremde, doch Ersatz.
Mein Heimweh hieß Savignyplatz.”)
Lewishamstraße (rechts)
Kantstraße (links)
(An der Kantstraße 125 zwischen Leibnizstraße und Krumme Straße baute Alfred Schrobsdorff 1908 ein Gartenhaus zur Privatsynagoge Beth Jitzchok für 280 Personen um. Sie war gleichzeitig Sitz des privaten Synagogenvereins Thorah-Chessed e.V. Am 9. November 1938 hinderte ein NSDAP-Mitglied, das im 1. Quergebäude wohnte, ein NS-Kommando daran, die Synagoge anzuzünden. Sie stand inmitten von Wohngebäuden.
Im Januar 1939 musste der Synagogenverein den Bet- und Versammlungsraum aufgeben. Danach wurden hier Büro- und Lagerräume eingerichtet. In den letzten Kriegstagen 1945 verschanzten sich SS-Männer in der ehemaligen Synagoge und lieferten sich mit Soldaten der Roten Armee heftige Feuergefechte)
Amtsgerichtsplatz: Mahnmal Treblinka
Neue Kantstraße
Dernburgstraße (links)
Dernburgstr. 57: Gedenktafel für Siegfried Jacobsohn
Hier, damals Dernburgstraße 25
lebte und arbeitete von 1910 bis 1921
SIEGFRIED JACOBSOHN
28.1.1881 – 3.12.1926
Gründer und Herausgeber
der unabhängigen Politischen Wochenschrift
“Die Weltbühne”
Demokrat und Pazifist, Verfechter von Meinungsfreiheit
und Völkerverständigung
Siegfried Jacobsohn starb am 3.12.1926. Sein wichtigster Weltbühnen-Mitarbeiter schrieb über ihn: “Er hat uns, Mitarbeiter und Leser, zu seinem Werk bekehrt; er liebte, wie wir, Deutschland und wusste, dass dessen schlimmste Feinde nicht jenseits des Rheines wohnen.”
Herbartstraße (links)
Herbartstraße 26: Leo-Baeck-Synagoge im jüdischen Altersheim
Der hier entstandene Komplex des Jeanette Wolff-Seniorenzentrums und des Leo-Baeck-Altenwohnheims mit der Leo-Baeck-Synagoge wurde 1981 eingeweiht.
Die Berliner SPD-Politikerin Jeantte Wolff war eine Überlebende des Holocaust. Sie gehörte zu den Frauen der ersten Stunde beim Aufbau der Jüdischen Gemeinde. Sie war Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und des Deutschen Bundestages, Stadtälteste, Vorkämpferin der liberalen Jüdischen Einheitsgemeinde nach dem Krieg und sozial engagiert in der Zentralwohlfahrtstelle der Jüdischen Gemeinde.
Der Rabbiner und Philosoph Leo Baeck war seit 1912 in der Berliner Jüdischen Gemeinde tätig, hoch angesehen als geistiger Führer und bis 1942 tätig an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. 1933 wurde er Präsident der Reichsvertretung der deutschen Juden. Nach seiner Befreiung aus dem KZ Theresienstadt lebte er in London.
Die von Hans Wolff-Grohmann entworfene Synagoge im Leo-Baeck Altenwohnheim enthält im Eingangsbereich Säulen aus der zerstörten Synagoge in der Oranienburger Straße.
Neue Kantstraße (links)
(In der seit 1866 entstandenen Villenkolonie lebten viele bedeutende Persönlichkeiten, darunter der Kritiker Julius Bab, die Lyrikerin Gertrud Kolmar, der Verleger und Kunstmäzen Bruno Cassirer, der Komponist Arnold Schönberg und der Philosoph Georg Simmel.
An dem Haus Hölderlinstraße 11 gibt es gleich zwei Gedenktafeln. Eine erinnert an Lilli Palmer:
“Hier lebte von 1917 bis 1932
LILLI PALMER
24.5.1914-27.1.1986
Schauspielerin und Schriftstellerin
Sie debütierte erfolgreich am Rose-Thater
1933 mußte sie Deutschland verlassen
Erfolge in Hollywood und ihre Filme in
Europa machten sie zu einer
Schauspielerin von internationalem Rang”
Geboren wurde sie als Lilli Maria Peiser. Ins Exil wurde sie von ihrem Vater geschickt. Er war Chefarzt des Jüdischen Krankenhauses. Als sie 20 Jahre später zurückkam, war sie ein Weltstar.
Die zweite Gedenktafel an dem Haus Hölderinstraße 11 erinnert an Erich Salomon:
“Hier lebte von 1912 bis 1932
ERICH SALOMON
28.4.1886-7.7.1944
Photograph
Mit seinen Photoreportagen
aus der Welt der
Politik, Kultur, Wissenschaft und der
Gesellschaft Europas und der USA
war er der Begründer des
modernen Bildjournalismus
Salomon wurde im
Konzentrationslager Auschwitz ermordet”)
Masurenallee
Das von Hans Poelzig entworfene Haus des Rundfunks mit dem Grundriss eines abgerundeten Dreiecks wurde in den Jahren 1929/1930 erbaut und am 22. Januar 1931 eingeweiht. Der zentrale Große Sendesaal entstand 1933. Für Joseph Goebbels wurde der Rundfunk zum wichtigsten Propagandainstrument.
Theodor-Heuss-Platz
Kaiserdamm (rechts)
Kaiserdamm 77-79: Gedenktafel für die Theodor-Herzl-Schule und Paula Fürst
Hier befand sich von 1933 bis 1938 die
THEODOR-HERZL-SCHULE
Der jüdische Schulverein hatte sie 1920 gegründet
als eine religiös neutrale zionistische Schule
mit koedukativer Erziehung
Ihre Leiterin Paula Fürst
wurde 1942 nach Auschwitz deportiert
und dort ermordet
Paula Fürst war eine der jüdischen Pädagoginnen, die in einer immer feindlicher werdenden Umwelt “Inseln der Geborgenheit” geschaffen haben. Die jüdischen Schulen waren für die meisten zunächst nur ein notdürftiger Ersatz für die regulären deutschen Schulen, von denen sie vertrieben worden waren. Aber sie wurden schnell zum Rettungsanker. Sie vermittelten Schutz und Hoffnung – Hoffnung auf das eigene Überleben und Hoffnung auf das Überleben der Kultur und Menschlichkeit. Paula Fürst war eine leidenschaftliche Pädagogin, die in einem Wilmersdorfer humanistischen Gymnasium zur Schule gegangen war, im Victoria-Luise-Oberlyceum, dem heutigen Goethe-Gymnasium an der Gasteiner Straße. Hier wurden ihr nicht nur Wissen und Techniken vermittelt, sondern auch Ethik und Moral, von der sie so lange nicht glauben konnte, dass sie seit 1933 plötzlich außer Kraft gesetzt waren. Auch die Montessori-Pädagogik, die sie – ebenfalls in Wilmersdorf – erstmals praktizierte, wurde von den Nationalsozialisten abgeschafft und verboten. Die Theodor-Herzl-Schule wurde 1938 geschlossen. Paula Fürst begleitete im August 1939 jüdische Kinder, die nach Großbritannien einreisen durften. Gegen den Rat ihrer Freunde kehrte sie nach Deutschland zurück, wo sie 1942 verhaftet wurde, um anschließend nach Auschwitz deportiert und ermordet zu werden.
Kaiserdamm 28: Gedenktafel für Alfred Döblin
Seit 2003 erinnert an dem Haus Kaiserdamm 28 eine Gedenktafel an Alfred Döblin:
In diesem Hause wohnte und praktizierte als Arzt
von 1930 bis 1933
Alfred Döblin
10.8.1878-26.6.1957
Schriftsteller, Dramatiker, Essayist
Er emigrierte aus Hitler-Deutschland
am Tag nach dem Reichstagsbrand
Seine Werke – darunter der Roman “Berlin Alexanderplatz”
fielen der Bücherverbrennung zum Opfer
Alfred Döblin lebte und praktizierte hier als Arzt, bevor er 1933 emigrieren musste. Mit seinem “Berlin Alexanderplatz” hat er seiner Heimatstadt das bedeutendste literarische Denkmal geschaffen. Er kam unmittelbar nach dem Krieg 1945 nach Berlin zurück und gab eine beklemmende Beschreibung, in der die Liebe zu seiner Heimat noch einmal aufscheint: “Später der Kurfürstendamm. Er war eine breite Straße, mit Bäumen bepflanzt, ein Boulevard, der sich bis nach Halensee hinzog, mit Prunk- und Protzhäusern, mit Kinos und Bars. Wer bewegt sich jetzt hier? Der Reichtum ist verjagt. In den Wracks der Häuser Läden, Parfümerien, Blumengeschäfte …”
Kaiserdamm 16: Gedenktafel für Armin T. Wegner
Seit 2002 erinnert auf dem Gehweg vor dem Haus Kaiserdamm 16 eine Gedenktafel am Armin T. Wegner:
Hier, im Hause Kaiserdamm 16,
lebte von 1925 bis zu seiner Verhaftung am 16. August 1933
der Schriftsteller, Lyriker und Journalist
ARMIN T. WEGNER
16.10.1886 – 17.5.1978
Als Augenzeuge berichtete er über den Völkermord an den Armeniern im 1. Weltkrieg.
In einem Brief an Hitler protestierte er schon im April 1933 gegen die Verfolgung der
Juden.
Als Pazifist denunziert, verschleppten ihn die Nationalsozialisten
in die Konzentrationslager Oranienburg, Börgermoor und Lichtenburg.
Seine Bücher wurden verbrannt, sein Werk verschwiegen.
In Armenien wie in Israel zählt er zu den
GERECHTEN DER VÖLKER
Witzlebenplatz (rechts)
Witzlebenstraße (links)
Witzlebenstr. 4-5: Ehem. Reichskriegsgericht, Denkzeichen
Das Gerichtsgebäude wurde 1908-1910 erbaut. Nachdem es jahrelang leer stand, wurde es jetzt zu einem luxuriösen Wohnhaus mit Mietwohnungen umgebaut.
Von 1910 bis 1920 fungierte das Gebäude als Reichsmilitärgericht, danach bis 1936 als Reichswirtschaftsgericht und Kartellgericht. 1936 zog hier das von den Nazis gegründete Reichskriegsgericht ein, der höchste Gerichtshof der NS-Wehrmachtsjustiz.
Er war zuständig für Hoch- und Landesverrat von Militärangehörigen, “Kriegsverrat” und Wehrdienstverweigerung aus religiösen Gründen. Mit Kriegsbeginn 1939 wurde seine Kompetenz erweitert auf die Delikte Spionage, Wirtschaftssabotage und “Wehrkraftzersetzung”. Aus den Jahren 1939 bis 1945 sind mehr als 1400 Todesurteile aktenkundig, von denen mehr als 1000 vollstreckt wurden. Insgesamt haben NS-Kriegsgerichte während des Zweiten Weltkriegs mehr als 30.000 Todesurteile verhängt, von denen die meisten vollstreckt wurden. Zum Vergleich: Während des gesamten Ersten Weltkriegs hat die Militärjustiz des Kaiserreichs insgesamt 150 Todesurteile verhängt, von denen 48 vollstreckt wurden.
Am bekanntesten wurden die Verfahren gegen die Widerstandsgruppe “Rote Kapelle”. Mehr als 50 Mitglieder der Gruppe wurden hier zum Tode verurteilt und in Plötzensee ermordet. Das Reichskriegsgericht war ein Instrument des Terrors des NS-Staates. 1943 zog das Gericht wegen der zunehmenden Luftangriffe nach Torgau um. Das letzte Urteil wurde am 10.4.1945 gefällt. Danach flohen die Richter in den Süden Deutschlands.
Keiner der Richter wurde nach dem Krieg verurteilt. Erst in den letzten Jahren wurden einige der von ihnen gefällten Urteile revidiert, und erst jetzt stellt sich auch die deutsche Justiz ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit.
Eine Gedenktafel für Franz Jägerstätter wurde 1997 an der Umfriedung des Gebäudes angebracht. Jägerstätter wurde hier wegen Kriegsdienstverweigerung 1943 zum Tode verurteilt und im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet. In der amerikanischen Friedensbewegung ist Jägersätter eine Symbolfigur wie Martin Luther King und Mahatma Gandhi.
“IN DIESEM GEBÄUDE WURDE DER
ÖSTERREICHISCHE BAUER
FRANZ JÄGERSTÄTTER (1907 – 1943)
VOM EHEMALIGEN REICHSKRIEGSGERICHT
WEGEN SEINER GEWISSENSENTSCHEIDUNG
GEGEN EINE KRIEGSTEILNAHME
AM 6. JULI 1943 ZUM TOD VERURTEILT.
MIT IHM GEDENKEN WIR ALL JENER,
DIE WEGEN EINER
GEWISSENSENTSCHEIDUNG OPFER
VON KRIEGSGERICHTEN WURDEN.”
Gegenüber der Gedenktafel für Franz Jägerstätter befindet sich ein Verkehrsspiegel, der auf das Mahnmal “Denkzeichen zur Erinnerung an die Ermordeten der NS-Militärjustiz am Murellenberg” hinweist. Das von der Berliner Künstlerin Patricia Pisani geschaffene Mahnmal wurde 2002 entlang des Waldweges von der Glockenturmstraße am Olympiastadion bis in die Nähe des Erschießungsortes hinter der Waldbühne aufgestellt. Es besteht aus 106 Verkehrsspiegeln. Auf sechzehn Spiegeln informieren eingravierte Texte über das Geschehen in der Murellenschlucht. Unter den Nationalsozialisten wurde dort eine Wehrmachtshinrichtungsstätte errichtet:
1988 wurde im Foyer des dritten Obergeschosses des Gerichtes eine Gedenktafel mit folgendem Text angebracht:
“Zum Gedenken
an die jüdischen Juristen unserer Stadt
1933 – 1945.
Den Richtern, Rechtsanwälten und Staatsanwälten,
die sich um das Ansehen der Rechtspflege in Berlin
verdient gemacht haben und Opfer der Verfolgung geworden sind.”
Mit dieser Gedenktafel wird an die jüdischen Rechtsanwälte, Notare, Richter und Staatsanwälte erinnert, die in den Jahren der faschistischen Diktatur Opfer des Rassismus geworden waren. Wie den Angehörigen anderer Berufszweige, wurde auch den jüdischen Rechtswissenschaftlern die Ausübung ihrer Tätigkeit untersagt. 1938 wurden den privaten Anwälten jüdischer Herkunft endgültig die Praxen geschlossen. Sie wurden entlassen, ihrer sozialen Existenz beraubt, gedemütigt, zur Emigration gezwungen. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslager in den Tod deportiert.
Die Gedenktafel wurde im Zuge des Umbaus des Hauses abmontiert und im Kammergerichtsgebäude am Kleistpark in Schöneberg angebracht.
Informationstafel
Zum Gedenken
In diesem Hause, Witzlebenstraße 4-10
befand sich von 1936-1943 das Reichskriegsgericht.
Die höchste Instanz der Wehrmachtsjustiz
verurteilte hier
260 Kriegsdienstverweigerer
und zahllose Frauen und Männer des Widerstands
wegen ihrer Haltung gegen Nationalsozialismus und Krieg
zum Tode
und ließ sie hinrichten.
Kaiserdamm (rechts)
Kaiserdamm 1: Ehemaliges Polizeipräsidium Charlottenburg, Bernhard Weiß
Nach der Eingemeindung Charlottenburgs nach Berlin im Jahr 1920 wurde hier die Kriminalpolizei untergebracht, und in den 20er Jahren war dies der Sitz des von den Nationalsozialisten wegen seiner jüdischen Herkunft diffamierten Berliner Vizepolizeipräsidenten und Chefs der Kriminalpolizei Bernhard Weiß.
Nach dem Abitur im Jahr 1900 studierte Bernhard Weiß Rechtswissenschaften in Berlin, München, Freiburg und Würzburg und schloss das Studium mit der Promotion ab.
1904/1905 absolvierte er eine militärische Ausbildung zum Reserveoffizier. Im Ersten Weltkrieg stieg er zum Rittmeister auf und wurde mit dem Eisernen Kreuz zweiter und erster Klasse ausgezeichnet.
Im Sommer 1918 wurde er als Stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei in Berlin in den Polizeidienst aufgenommen, 1925 wurde er Chef der Kriminalpolizei und 1927 Vizepolizeipräsident.
Weiß, der Mitglied der DDP war, griff als Beamter der Republik gegen Rechtsbrüche systematisch durch. Er wurde Opfer regelmäßiger Diffamierungskampagnen der aufkommenden NSDAP unter dem Berliner Gauleiter Joseph Goebbels, der Weiß wegen seiner jüdischen Herkunft stets als “Isidor Weiß” bezeichnete. Besonders in Goebbels Hetzpostille “Der Angriff” war Weiß ständig Gegenstand antisemitisch motivierter Diffamierungen in Texten und Karikaturen. Mit Weiß hatte Goebbels einen Feind gefunden, der seiner Nazi-Ideologie entsprach: ein Bürger jüdischer Herkunft und Repräsentant der Republik, im Nazijargon “Vertreter des Systems”. Weiß führte gegen Goebbels mehr als 60 erfolgreich verlaufende Prozesse.
Als Vizepolizeipräsident bekämpfte Weiß die Pöbeltruppen der SA und gleichermaßen die Kampfformationen der Kommunisten, die der Weimarer Republik ebenfalls feindselig gegenüberstanden.
In der Berliner Bevölkerung und in der Polizei war Weiß sehr populär und geachtet. Liebevoll-despektierlich nannten sie ihn “Vipoprä”.
Nach dem “Preußenschlag” Papens 1932 verlor Weiß – wie die gesamte Regierung Preußens – sein Amt. Nach kurzer Haft wurde er freigelassen und lebte bis zum März 1933 in Berlin. Als die Nazis ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatten, ermöglichten ihm Kollegen die Flucht. Weiß floh 1933 über Prag nach London, wo er 1951 kurz nach der Wiedererlangung seiner deutschen Staatsbürgerschaft im Alter von 70 Jahren starb.
Schloßstraße (links)
Schloßstr. 55: Villa Oppenheim
Die Villa Oppenheim wurde 1881/82 von Christian Heidecke im Neorenaissancestil mit Remisengebäuden und großzügiger Gartenanlage für den Obertribunalrat Otto Georg Oppenheim erbaut. Sein Sohn Hugo Oppenheim verkaufte 1911 den gesamt Komplex an die Stadt Charlottenburg. Die Stadt ließ 1911 den Nordflügel und sämtliche Nebengebäude abreißen und bezog die Villa in den Gebäudekomplex der 1919-22 von Hans Winterstein errichteten Sophie-Charlotte-Schule, der heutigen Oppenheim-Oberschule mit ein. Die private Gartenanlage wurde in den öffentlich zugänglichen Schustehruspark umgewandelt. Nach schweren Kriegsschäden wurde die Villa 1945 mit einem flachem Notdach gesichert, 1985/86 wurde sie umfassend restauriert. Seither wird ein Teil des Hauses für Ausstellungen genutzt.
Schloßstr. 1a: Bröhan-Museum, ehemalige SS-Führerschule
In dem 1892/93 errichteten Mannschaftsgebäude und Offizierswohnhaus der Garde-du-Corps an der Schloßstraße 1a, in dem sich seit 1929 ein Polizei-Institut befand und heute das Bröhan-Museum seine Jugendstil-Sammlung präsentiert, richteten die Nationalsozialisten die SS-Führerschule der Sicherheitspolizei ein. Hier wurden auch SS-Männer ausgebildet, die als Leiter der berüchtigten Einsatzkommandos im Ostfeldzug an der Ermordung tausender Juden in Osteuropa beteiligt waren. Eine Gruppe von ihnen baute nach dem Zweiten Weltkrieg in einflussreicher Position das Bundeskriminalamt auf. Sie nannten sich die ‘Charlottenburger’.
Schloßstr. 1: Museum Berggruen
Eine der für Berlin glücklichsten und bewegendsten jüdischen Geschichten ist die von Heinz Berggruen. Sie beginnt in Wilmersdorf und endet in Charlottenburg: “Wurde ich als Kind gefragt, wo ich herkäme, sagte ich nicht, aus Berlin, sondern antwortete: aus Wilmersdorf, und das war nicht etwa Ausdruck von Snobismus oder kindlichem Trotz, sondern entsprach den städtischen Realitäten vor 1914… Meine eigentliche Heimat blieb Wilmersdorf.“14. Der 1914 in Wilmersdorf geborene Kunsthändler und Sammler emigrierte 1936 nach San Francisco und erwarb die amerikanische Staatsbürgerschaft, kam 1941 als US-Soldat zurück nach Europa und eröffnete 1947 eine eigene Galerie in Paris. Er wurde zu einem der international angesehensten Experten für die Kunst der klassischen Moderne. Mit Pablo Picasso verband ihn eine enge Freundschaft. Er baute eine der weltweit bedeutendsten Privatsammlungen mit Werken der Klassischen Moderne auf, die er 1995 seiner Vaterstadt Berlin als
Dauerleihgabe zur Verfügung stellte. Sie wurde am 6. September 1996 im westlichen der beiden Stülerbauten gegenüber dem Schloss Charlottenburg unter dem Titel “Picasso und seine Zeit – die Sammlung Berggruen” eröffnet, später in “Museum Berggruen” umbenannt. Am 21. Dezember 2000 ging die Sammlung in den Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über. Picasso ist mit 80 Exponaten vertreten, den zweiten Schwerpunkt bilden Arbeiten von Paul Klee. Das Museum ist einer der bedeutendsten kulturellen Anziehungspunkte Berlins. Berggruen selbst wohnte seit 1996 in seinem Museum, mischte sich häufig unter die Besucherinnen und Besucher seiner Kunstwerke und war stolz auf seine Charlottenburger Adresse Schloßstraße 1.
Bereits 1973 hatte Berggruen seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben und wieder die deutsche angenommen: “Obwohl es mir in Paris gutging, sah ich nicht ein, warum ich mich um einen französischen Pass bemühen sollte. Es erschien mir viel sinnvoller, die Nationalität wieder zu erwerben, die mir ein barbarisches Regime ein halbes Menschenalter zuvor weggenommen hatte. Durch Sprache, Literatur, Geschichte und durch die deutsche Landschaft habe ich Bindungen an meine Heimat, die kein ‘Tausendjähriges Reich’ je zerstören konnte.“15
Er starb am 23.2.2007 in Paris und wurde in Berlin auf dem Dahlemer Waldfriedhof beerdigt. Die Erben von Heinz Berggruen wollen das Museum um fünfzig Werke der Klassischen Moderne erweitern, darunter Picasso, Matisse, Klee und Cézanne.
Berggruens Bücher sind bewegende Zeugnisse seiner großen Heimatliebe: “Auf den Haupt- und Nebenwegen des Sammelns führten die Spuren zurück zu meinen Anfängen, ins Berlin meiner Kindheit und Jugend. Dies erscheint mir als glückliche Fügung. Ich verstehe diesen Schritt aber auch als ein Zeichen der Versöhnung, als einen Beitrag zur Anerkennung und Bestätigung eines wieder in die Völkergemeinschaft integrierten, friedfertigen und demokratischen Staates. … Mein Freund Ernst Stiefel sagte: ‘Man kann einen Menschen aus der Heimat vertreiben, aber nicht die Heimat aus dem Menschen.’ … Mit zweiundzwanzig Jahren bin ich aus Berlin fortgegangen, in eine ungewisse Zukunft. Als Zweiundachtzigjähriger bin ich zurückgekommen. Und das ist gut so.”
Spandauer Damm (rechts)
Otto-Suhr-Allee
Wilmersdorfer Straße (rechts)
Behaimstraße (links)
Behaimstraße 11: Gedenktafel für die ehemalige Vereinssynagoge Charlottenburg
Hier stand die älteste Synagoge Charlottenburgs
1889 von der
JÜDISCHEN RELIGIONS-GEMEINSCHAFT CHARLOTTENBURG e.V.
erbaut, wurde sie in der Pogromnacht des 9. November 1938
verwüstet und im Krieg durch Bomben zerstört
Richard-Wagner-Straße (links)
Otto-Suhr-Allee (rechts)
Otto-Suhr-Allee 93: Gedenkstele für Magnus Hirschfeld
1995 wurde hier eine Gedenkstele für Magnus Hirschfeld enthüllt:
“In dem hier ehemals stehenden Haus lebte von 1896 bis 1910 der Arzt und Sexualwissenschaftler Dr. Magnus Hirschfeld.
In Charlottenburg begann Dr. Hirschfeld am 15. Mai 1897 mit dem Aufbau der ersten deutschen Homosexuellen-Bewegung als Gründer und Vorsitzender des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees (WHK). Ferner entstanden hier die Pläne für das spätere Berliner “Institut für Sexualwissenschaft”.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sah sich das WHK 1933 gezwungen, sich selbst aufzulösen. Das engagierte Wirken von Magnus Hirschfeld mahnt bis heute zu Toleranz und Akzeptanz gegenüber Minderheiten in unserer Gesellschaft.”
Leibnizstraße (rechts)
( Pestalozzistraße 14/15: Liberale Synagoge
Links von uns in der Pestalozzistraße 14/15 befindet sich eine der wenigen intakt gebliebenen Synagogen, die heute wieder als jüdisches Gotteshaus benutzt werden. Die liberale Synagoge wurde 1911-13 auf Initiative der Charlottenburger Geschäftsfrau Betty Sophie Jacobsohn nach Entwürfen von Ernst Dorn als rotes Backsteinbauwerk im Hof innerhalb der geschlossenen Bebauung in neoromanischem Stil errichtet. Sie bot 1400 Personen Platz. 1919 übernahm die Berliner jüdische Gemeinde die Vereinssynagoge. Sie wurde zwar in der Pogromnacht 1938 demoliert, aber wegen der eng benachbarten Häuser nicht angezündet. 1942 wurde das Haus zwangsweise enteignet. Nach dem Krieg wurde es an die Jüdische Gemeinde zurück gegen und bereits 1947 nach erfolgter Renovierung wieder eingeweiht. Seitdem finden hier Gottesdienste nach liberalem Ritus statt. Hier war Estrongo Nachama bis zu seinem Tod Anfang 2000 Oberkantor.)
Kantstraße (links)
(Bleibtreustr. 10)
Hier lebte von 1936-1938
die Dichterin
MASCHA KALÉKO
7.06.1907-21.01.1975
Das Deutschland von damals
trieb sie ins Exil und verbot ihre Bücher.
Sie emigrierte 1938 nach New York,
lebte seit 1966 in Jerusalem.
In der von deutschen Emigranten in Amerika gegründeten Zeitung “Aufbau” veröffentlichte Mascha Kaléko unter anderem folgendes Gedicht:
“Ich bin, vor jenen ‘tausend Jahren’
Viel in der Welt herumgefahren.
Schön war die Fremde, doch Ersatz.
Mein Heimweh hieß Savignyplatz.”)
Kantstr. 30: Gedenktafel für Else Ury
Hier erinnert eine Gedenktafel an Else Ury. Sie war das dritte von vier Kindern einer liberal-bürgerlichen Fabrikantenfamilie. Sie besuchte zehn Jahre eine angesehene städtische Mädchenschule. 1905 zog die Familie hierher in die Kantstraße 30 um. Hier entstanden ihre Erfolgsserien über “Nesthäkchen” mit einer Auflage von 5 Millionen und “Professor Zwilling” mit einer Auflage von 7 Millionen. Else Ury wurde damit zur Lieblingsautorin mehrerer Mädchengenerationen. Von 1933 bis 1939 lebte sie am Kaiserdamm 24. 1935 wurde sie als Jüdin aus der Reichsschriftumskammer ausgeschlossen. Die 65jährige wurde am 12. Januar 1943 vom Bahnhof Grunewald aus deportiert, am 13. Januar im Konzentrationslager Auschwitz als arbeitsunfähig eingestuft und am selben Tag ins Gas geschickt.
Savignyplatz
Carmerstraße (links)
Steinplatz 3: Gedenktafel für Bernhard Weiß
“In diesem Haus lebte bis zum März 1933
BERNHARD WEISS
30.7.1880 – 29.7.1951
Jurist, Polizeivizepräsident in Berlin von 1927 bis 1932
Als Jude und Demokrat vom NS-Regime verfolgt
mußte er nach der Erstürmung seiner Wohnung durch die SA
über Prag ins Londoner Exil fliehen
Kurz vor Wiedererlangung der ihm von den Nationalsozialisten
aberkannten deutschen Staatsbürgerschaft
starb Bernhard Weiß in London”
Hardenbergstraße (rechts)
Im Foyer der Universität der Künste erinnert eine Messingtafel an den berühmten Geiger Joseph Joachim:
“JOSEPH JOACHIM
1831-1907
Gründer und erster Direktor
der königlich-akademischen Hochschule
für die Musik in Berlin 1869-1907
Zum 150. Geburtstag von Joseph Joachim.
Geschenk der Karl Klingler-Stiftung.
Zweitguss der im März 1936
von den Nationalsozialisten
aus der Hochschule entfernten
und unauffindbaren Orginalbüste.
Mit der Wiedererrichtung wird
ein Vermächtnis Karl Klinglers erfüllt,
der gegen die Entfernung der Büste
protestierte und daraufhin seine
Professur verlor.
München – Berlin, 1981.”
Fasanenstraße (rechts)
Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum Ausgangspunkt unserer Rundfahrt zurück, und ich hoffe, es war ein Gewinn für Sie. Sowohl die Täter und ihre Nachkommen als auch die Opfer und ihre Familien hatten in der Nachkriegszeit Schwierigkeiten, über das Erlebte zu sprechen. Die Erinnerung daran wurde meistens verdrängt. Inzwischen hat sich das geändert. Und das ist gut so. Wir sind es nicht nur den Opfern schuldig, dass wir sie nicht vergessen, sondern es ist auch für uns selbst wichtig, dass wir unsere Verantwortung vor unserer Geschichte wahrnehmen. Es geht für unsere Generation und für unsere Kinder nicht um Schuld. Aber es geht um Verantwortung: Um aus der Geschichte lernen zu können und zu verhindern, dass etwas Ähnliches jemals wieder geschieht, müssen wir unsere Geschichte kennen.
Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb wir zur Erinnerung verpflichtet sind: Es ist ein großes Glück, dass wieder jüdische Bürgerinnen und Bürger bei uns und mit uns zusammen leben und sich für unsere Gesellschaft engagieren. Der Umgang miteinander ist noch immer nicht unbefangen. Aber eine Verständigung ist nicht möglich, wenn wir die gemeinsame Geschichte ignorieren, sondern nur wenn wir uns ihrer bewusst sind und offen damit umgehen.
Wir wissen, dass die Erinnerung nie abgeschlossen sein wird. Erinnerung bedeutet ständiges Forschen, und jede neue Generation wird sich die Erinnerung neu erarbeiten müssen. Deshalb wird es noch viele Stolpersteine und viele Gedenktafeln geben, die unsere Erinnerung auch öffentlich wach halten. Ich denke, dass wir mit dieser Rundfahrt 70 Jahre nach dem 9. November 1938 einen kleinen Beitrag zur Erinnerungsarbeit geleistet haben.