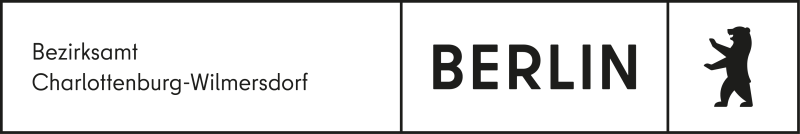Münchener Str.37: Löcknitz-Grundschule
Die Grundschulen in Schöneberg wurden nach märkischen Landschaften benannt. Die Löcknitz-Grundschule erhielt ihren Namen nach einem Nebenfluss der Spree.
Für ihre knapp 400 Schülerinnen und Schüler hat die Schule als Leitbild formuliert: “Wir sind eine Schule, die die Vergangenheit nicht verdrängt, die Gegenwart mutig gestaltet und die Zukunft verantwortungsvoll vorbereitet.”
Denksteinmauer
Im Schuljahr 1994/95 entstand nach einer Anregung des Kasseler Künstlers Horst Hoheisel im Rahmen der Unterrichtseinheit „Nationalsozialismus“ in einer 6. Klasse die Idee, eine Denksteinmauer für jüdische Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Schöneberg auf dem Schulgelände zu errichten. Seither kommen jedes Jahr neue Denksteine dazu, immer von Schülerinnen und Schülern des jeweiligen 6. Jahrgangs.
Oft wird an Menschen erinnert, die vor ihrer Deportation in der derselben Straße wohnten oder am gleichen Tag Geburtstag hatten wie die Schülerinnen und Schüler, die den Stein gestalten. In diesem Jahr wurde der 1000. Stein eingefügt, und die Denk-Stein-Mauer wird weiter wachsen.
Synagoge
1909 erwarb der Synagogenverein Schöneberg dieses Grundstück. Er ließ ein Vorderhaus mit Wohnungen bauen, in dem sich auch Schulräume, ein Rabbinerzimmer sowie ein Betsaal befanden. Die eigentliche Synagoge wurde auf dem Hof errichtet. Es war ein fast quadratischer Kuppelraum mit Platz für 836 Menschen. Durch die Wohnlage wurde diese Synagoge im November 1938 nicht angezündet. Sie wurde aber nach 1938 von den Nationalsozialisten als Sammelstelle für die von der jüdischen Bevölkerung abzugebenden Wertgegenstände benutzt. Während des Weltkrieges wurde das Vorderhaus zerstört. Die Ruine wurde 1956 abgerissen. Die nur noch sehr kleine Jüdische Gemeinde verkaufte das Grundstück an den Bezirk Schöneberg zur Erweiterung des Schulhofs der Löcknitz-Grundschule. Heute steht der Schulpavillon etwa an der Stelle der Synagoge.
Am 8. November 1963 wurde auf Initiative der Bezirksverordnetenversammlung von Schöneberg der Gedenkstein des Bildhauers Gerson Fehrenbach eingeweiht. Er ist eines der ersten öffentlichen Denkmale in Berlin, das an die Verbrechen an den Berliner Juden erinnert. Jedes Jahr findet am 9. November am Denkmal eine Gedenkveranstaltung statt.
Der Text auf der Steintafel lautet:
“Hier stand die 1909 erbaute
Synagoge der Jüdischen Gemeinde.”
Am Sockel des Denkmals wurde später eine Bronzetafel mit folgendem Text eingelassen:
“Hier stand von 1909-1956 eine Synagoge.
Sie wurde während der Reichspogromnacht
am 9. Nov. 1938 wegen ihrer Lage in einem
Wohnhaus nicht zerstört.
Nach der Vertreibung und Vernichtung
der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger
durch die Nationalsozialisten verlor sie
ihre Funktion und wurde 1956 abgerissen.”
Ergänzend zu diesem Text ist zu sagen, dass die Jüdische Gemeinde sich damals vergeblich um den Erhalt der Synagoge bemüht hat. Die Stadt Berlin hat nach dem Kauf des Grundstücks den Abriss veranlasst.
Gegenüber dem Gedenkstein ist auf einer Tafel des Denkmals zu lesen:
“Die jüdischen Kultusvereinigungen haben
für die Beseitigung der Synagogenruinen zu sorgen.
Der Wiederaufbau ist nicht gestattet.
24.3.1939”
Naumann:
Dieser Satz trifft zwar auf die Synagoge hier in der Münchener Straße nicht zu, denn sie wurde ja am 9. November 1938 kaum beschädigt. Er gilt aber für die große Synagoge Wilmersdorf, die 1930 unweit von hier in der Prinzregentenstraße eingeweiht wurde – als liberale Synagoge auch für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Bayerischen Viertels.
Nach der schweren Beschädigung dieser Synagoge in der Pogromnacht 1938 wurde die jüdische Gemeinde von der damaligen Wilmersdorfer Bauaufsicht aufgefordert, die Schäden auf eigene Kosten zu beseitigen, damit Passanten auf dem Gehweg nicht gefährdet wurden. Der Architekt Alexander Beer musste daraufhin 8 Jahre nach dem Bau den Teilabriss der Synagoge organisieren. Das war für das Bezirksamt Wilmersdorf 1988 der Anlass, die Geschichte der “Kommunalverwaltung unterm Hakenkreuz” am Beispiel der eigenen Bezirksverwaltung zu erforschen.
Schöttler:
Münchener Str. 18a: Stolperstein für Gertrud Kolmar
Vor dem Haus an der Münchener Straße 18a erinnern zwei Stolpersteine an Ludwig Chodziesner seine Tochter Gertrud Kolmar. Die Lyrikerin und Schriftstellerin war eine Cousine von Walter Benjamin und lebte zuletzt mit ihrem Vater hier in einem sogenannten “Judenhaus”. In solchen Häusern wurden Juden, nachdem sie aus ihren Wohnungen vertrieben worden war, bis zur Deportation untergebracht.
Gertrud Kolmar wuchs als Tochter des jüdischen Rechtsanwalts Ludwig Chodziesner im vornehmen Charlottenburger Stadtteil Westend auf. Ihr Pseudonym erklärt sich aus der Herkunft ihres Familiennamens von der polnisch/preußischen Stadt Chodziesen, die 1878 in Kolmar umbenannt worden war.
Seit Juli 1941 musste Gertrud Kolmar in Lichtenberg Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten. 1943 wurde sie in Auschwitz ermordet. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts.
Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse an unserer Sophie-Scholl-Schule haben unter dem Titel “Lernen durch Stolpern” einen Kalender für 2013 gestaltet, in dem ein Kalenderblatt Gertrud Kolmar gewidmet ist. Der Kalender wurde von der Deutschen Gesellschaft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegeben.
Rosenheimer Straße
Die Rosenheimer Straße wurde 1904 nach der bayerischen Stadt benannt.
Heilbronner Str.20: Kirche zum Heilsbronnen
Die Kirche zum Heilsbronnen feiert in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen. Sie wurde 1912 als evangelische Kirche des bayerischen Viertels eingeweiht.
Landshuter Straße
Die Landshuter Straße wurde bereits 1902 nach der bayerischen Stadt benannt.
Wir passieren zwei weitere Tafeln des Denkmals “Orte des Erinnerns”:
“Berufsverbote für jüdische
Schauspielerinnen und Schauspieler.
5.3.1934”
und
“Juden dürfen keine Zeitungen
und Zeitschriften mehr kaufen.
17.2.1942”
Wenn wir von der Landshuter Straße in die Haberlandstraße einbiegen, dann erhalten Sie anhand von einigen erhalten gebliebenen Häusern aus der Gründerzeit einen Eindruck vom Bayerischen Viertel im Originalzustand. Die zeitgenössische Architekturkritik empfand es als ein wenig altmodisch und nannte es auch “Klein-Nürnberg”.