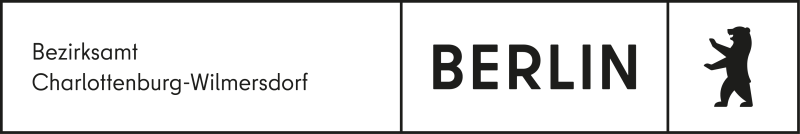HIER WOHNTE
SIDONIE HAPP
GEB. BLUMENTHAL
JG.1880
DEPORTIERT 5.9.1942
RIGA
ERMORDET 8.9.1942
Sidonie Happ wurde als Sidonie Blumenthal am 17. November 1880 in Wiesbaden geboren. Sie war das jüngste Kind von Gerson Blumenthal und seiner Frau Fanny, geb. Jessel. Sie hatte vier wesentlich ältere Geschwister, Bertha, 1865 geboren, der ein Jahr jüngere Joseph, Siegfried, Jahrgang 1871 und Leo, 1873 geboren. Gerson Blumenthal, 1830 in Holzhausen a.d. Aar auf die Welt gekommen, war zunächst Pferde-, dann auch Kohlenhändler. Er wohnte in der Faulbrunnenstraße 3, später in der Dotzheimer Straße 14. Als Sidonie 16 Jahre alt war, starb ihr Vater, die Mutter drei Jahre später, 1899. Die Kohlehandlung führten die Brüder Joseph und Siegfried weiter, Bertha hatte bereits 1887 den Rentner Joseph Neu geheiratet. Leo war Inhaber der „Kölner Arbeiter-Kleiderfabrik-Niederlage“, Wellritzstraße 10, wohnte aber im Elternhaus in der Dotzheimer Straße.
1900 starb Leo nur 27-jährig und Sidonie übernahm – laut Adressbuch für 2 Jahre – die „Kölner Arbeiter-Kleiderfabrik-Niederlage“ als „Inhaberin“. Sidonie selbst wohnte auch in der Dotzheimer Straße 14. Vielleicht über die Firma begegnete sie dem Ingenieur Max Lachmann, den sie in 1. Ehe heiratete – wann und wo wissen wir nicht genau. Die Berliner Adressbücher verzeichnen Max Lachmann erst ab 1924 als Oberingenieur, wohnhaft am Kurfürstendamm 43, eine vornehme Adresse. Wenige Jahre später, wohl 1928, starb er und die Witwe Sidonie, genannt Sidi, blieb in der Wohnung am Kurfürstendamm. Unbekannt ist, ob sie mit Max Lachmann Kinder hatte.
1930 heirate Sidonie ein zweites Mal, und zwar den Witwer Isidor Happ. Isidor Happ, ursprünglich Kaufmann, war Kassenbeamter der Jüdischen Gemeinde. Er hatte drei erwachsene Kinder von seiner ersten Ehefrau Helene: Leo, Hans und Edith. Isidor Happ zog in Sidonies Wohnung mit ein.
1935 – Isidor Happ hatte wohl das Pensionsalter erreicht – zog das Ehepaar in eine vermutlich kleinere 3 ½ Zimmer-Wohnung in der Bleibtreustraße 17. Im Adressbuch wird Isidor Happ nur noch als Kaufmann bezeichnet. Die Zeiten erlaubten Juden keinen Luxus mehr. Die Nationalsozialisten waren an der Macht, Juden wurden nicht nur offen diskriminiert, ihre sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten wurden eingeschränkt, judenfeindliche Schilder aufgestellt, in- und ausländisches Vermögen musste angegeben werden. Berufsbeschränkungen und –verbote für Beamte, Juristen, Ärzte mögen Isidor Happ nicht mehr direkt betroffen haben, die allgemeine antisemitische Haltung, bekam er sicherlich zu spüren. Die Lage verschärfte sich dramatisch nach den Pogromen vom 9./10. November 1938. Nach einer Quelle soll Isidor Happ auch kurzfristig in Sachsenhausen inhaftiert worden sein. In atemberaubender Folge wurde schon ab 12. November eine große Zahl von Verordnungen erlassen, die
auch das Alltagsleben aller Juden betrafen. Eine „Sühnezahlung“ für Juden wurde festgelegt, Schul- und Hochschulbesuch wurde gänzlich untersagt, Bannbezirke und Sperrstunden bestimmt, Wertsachen aber auch Radios und Führerscheine mussten abgegeben werden, über Vermögen konnte nicht mehr frei verfügt werden, Theater-, Kino-, Museen-, Sportplatzbesuche u.ä. wurden Juden verboten, sie durften nur beschränkt öffentliche Verkehrsmittel benutzen, und vieles mehr.
Am 7. März 1941 starb Isidor Happ. So blieben ihm weitere antisemitische Maßnahmen erspart, nicht aber Sidonie. Juden mussten ab September 1941 den Judenstern tragen, sie mussten Pelze und Wollsachen abgeben, sie durften öffentliche Verkehrsmittel gar nicht mehr benutzen, auch keine öffentliche Telefone, sie durften nur noch jüdische Friseure in Anspruch nehmen, mussten Elektrogeräte, Schreibmaschinen u.ä. entschädigungslos und ohne Quittung abliefern, Bücher durften sie nur bei der Reichsvereinigung der Juden kaufen.
Auch die Wohnverhältnisse verschlechterten sich. Viele Juden mussten ihre Wohnungen für Nichtjuden räumen, sie wurden bei anderen Juden als Untermieter eingewiesen. Auch Sidonie musste sich – vielleicht erst nach Isidors Tod – einschränken, sie hatte zwei Untermieterinnen aufzunehmen, Tana Kristeller und Hanna Wolff.
Ende August 1942 musste auch Sidonie Happ die obligate Vermögenserklärung ausfüllen, die der Deportation vorausging. Sie wurde in die als Sammellager missbrauchte Synagoge in der Levetzowstraße 7-8 gebracht und am 5. September 1942 vom Güterbahnhof Moabit aus mit weiteren 790 Berliner Juden nach Riga deportiert. Dort am 8. September angekommen, wurden nur einige Männer mit handwerklichen Berufen aussortiert, alle anderen sofort erschossen, auch die 61-jährige Sidonie Happ.
Sidonies älterer Bruder Joseph und seine Frau Lina, geb. Schaumburg wurden vier Tage vor Sidonies Deportation am 1. September 1942 per Zug nach Frankfurt gebracht – die Fahrkarte hatten sie selber zu zahlen – und von dort aus nach Theresienstadt deportiert. Vier Wochen später, am 29. September, wurden sie weiter nach Treblinka verschleppt und auf Ankunft ermordet. Der zweite Bruder, Siegfried, war bereits 1936, nachdem er in „Schutzhaft“ genommen worden war, mit seiner Frau Lucie, geb. Altmann in die Niederlande geflüchtet, dort aber schon im Januar 1937 gestorben. Seine Witwe emigrierte weiter nach Südafrika, wo sie aber auch schon 1943 starb. Das Schicksal der älteren Schwester Bertha Neu und ihrem Mann ist nicht bekannt. Da sie nicht in den Gedenkbüchern stehen, kann man hoffen, dass sie nicht durch das NS-Regime umgekommen sind.
Quellen:
Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Akten der Oberfinanzdirektion; Stadtarchiv Wiesbaden; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005
Recherchen/Text: Micaela Haas