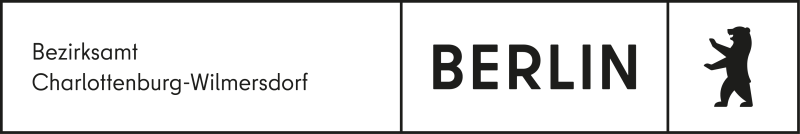HIER WOHNTE
FRIDA DRESEL
GEB. AUERBACH
JG. 1890
DEPORTIERT 14.7.1942
THERESIENSTADT
ERMORDET 16.5.1944
AUSCHWITZ
Frieda Dresel kam als Frieda Auerbach (selten auch Frida geschrieben) in Berlin am 15. Februar 1890 zur Welt. Der Vater war der Kaufmann Moritz Auerbach, die Mutter Josepha geb. Wahl. Die Eltern wohnten in der Neuen Königsstraße 85, Moritz Auerbach unterhielt eine „Lumpenhandlung engros“ in der Greifswalder Straße 5. Frieda war das älteste Kind, sie sollte noch drei Geschwister bekommen: Hedwig 1891 geboren, Franz 1892 und Nesthäkchen Gertrud 1899. Nach Hedwigs Geburt zogen Auerbachs um in einen Neubau in der gleichen Straße, Nr. 39. Auch das Geschäft, nun als Lumpenhandlung und Papier-Sortieranstalt“ bezeichnet, wechselte die Adresse, sie lautete nun Greifswalder Straße 59.60, später nummeriert in 212/213. Als Frieda 6 oder 7 Jahre alt war, zog Moritz Auerbach in die damalige Landgemeinde Oberschöneweide, in das Conrad‘sche Haus an der Chausseestraße, neben dem beliebten Ausflugslokal Sadowa gelegen. Oberschöneweide war dabei, sich zum
Industriestandort zu entwickeln und auch Moritz Auerbach siedelte seinen Betrieb dorthin um, jetzt als „Papier- und Pappen-Fabrik Sadowa Moritz Auerbach & Co“. Das Ausflugslokal und nun auch die Fabrik waren benannt nach einem tschechischen Dorf in der Nähe des Schlachtfelds von Königgrätz, wohl um den Sieg 1866 Preußens über Österreich und Sachsen zu ehren – er gilt als Wegbereiter für die Gründung des Deutschen Reiches. Die nächstgelegene Bahnstation hieß auch Sadowa, heute ist es der Bahnhof Wuhlheide.
Möglicherweise war der Umzug keine gute Entscheidung Moritz Auerbachs. Jedenfalls beschloss er schon kurz darauf, 1899, in die USA auszuwandern. Er schiffte sich am 8. Oktober erst mal allein nach New York ein, am 13. Dezember folgte dann Josepha mit den vier Kindern, die kleine Gertrud war gerade ½ Jahr alt, Frieda 9 Jahre.
Die Auswanderung scheint den Auerbachs auch kein Glück gebracht zu haben. Schon 1900 finden wir Josepha wieder hier, jetzt in Charlottenburg, Grolmanstraße 68, offenbar ohne Moritz. Hatten sie sich getrennt? Oder war er kurz nach der Ankunft verstorben? Wir wissen zwar, dass er in New York starb, aber nicht wann genau. Josepha, im Adressbuch nur als „Frau“ bezeichnet, ist dort erst wieder 1907 eingetragen, jetzt als Witwe. War sie zwischendurch noch mal in den USA? Oder, was wahrscheinlicher ist, hatte sie einige Jahre in Charlottenburg oder Berlin zur Untermiete gewohnt?
Nach zwei Wohnungswechseln in die Leibniz- und die Herderstraße, findet Josepha mit ihren Töchtern eine Wohnung in der Goethestraße 61, in der sie bis zu ihrem Tod 1928 bleiben wird. Der Sohn Franz fuhr wahrscheinlich 1911 wieder in die USA: Passagierlisten führen einen 18-jährigen Franz Auerbach aus Berlin auf.
Vier Jahre nachdem Friedas jüngere Schwester Hedwig 1913 geheiratet hatte, heiratete auch sie. Der Bräutigam war der zwei Jahre jüngere „Assistenzarzt der Reserve“ Dr. Kurt Max Dresel. Dieser hatte bis dahin auch in der Herderstraße gewohnt und war möglicherweise ein Freund von Friedas Bruder gewesen. Das Paar nahm eine Wohnung in der Schillerstraße 19, in unmittelbarer Nähe sowohl von Josephas Wohnung sowie von der Herderstraße 2, in der weiterhin Kurts Mutter Else lebte. Kurt richtete in der Schillerstraße auch seine Praxis für innere Krankheiten ein. 1919 bis 1930 war er Assistenzarzt an der Charité, danach Chefarzt am Städtischen Krankenhaus Britz. Er schlug auch eine Universitätskarriere ein: 1923 habilitierte er und wurde Privatdozent, bald darauf außerordentlicher Professor an der Charité. Nach Josephas Tod zogen Kurt und Frieda in die vornehmere Margaretenstraße 4 im Grunewaldviertel.
Soweit wir wissen, hatten Kurt und Frieda keine Kinder. Mit Machtantritt der Nationalsozialisten wurde Kurt als Chefarzt entlassen und die Lehrbefugnis wurde ihm kurz darauf aberkannt. Im Januar 1935 ließen Frieda und Kurt sich scheiden. Sechs Wochen später heiratete er erneut und zog um nach Tiergarten. Frieda hatte von da an, folgt man dem Adressbuch, keine eigene Wohnung, sie wohnte zur Untermiete, vielleicht schon in der Giesebrechtstrasse 12. Dokumentiert ist, dass sie dort 1939 lebte, als Untermieterin von Sophie Rosenthal. So wurde es bei der Volkszählung vom 17. Mai 1939 festgehalten, bei der Juden in einer gesonderten Kartei erfasst wurden.
Für Juden war mittlerweile das Leben äußerst schwer geworden. Zahlreiche diskriminierende und ausgrenzende Verordnungen verwehrten ihnen berufliche Tätigkeiten und schränkten ihren Alltag drastisch ein. Auch über ihr Geld konnten sie nicht mehr frei verfügen. Ihre Wohnungen mussten sie zugunsten von Nichtjuden räumen um in „Judenhäusern“ oder „Judenwohnungen“ zusammengepfercht zu werden.
Auch Frieda Dresel musste aus der Giesebrechtstraße ausziehen und bekam ein Zimmer in der Mommsenstraße 52 bei Schmey zugewiesen. Schikanen und Verfolgung von Juden sollten sie zum Verlassen Deutschlands zwingen, andererseits wurde die Emigration durch etliche Auflagen erschwert. Zudem wurde es immer schwieriger, ein Visum für ein Aufnahmeland zu bekommen, nach Kriegsausbruch fast unmöglich. Kurt konnte mit seiner 2. Frau in die USA fliehen, Frieda, die schon als Kind in den USA gewesen war, fand keine Möglichkeit zur Auswanderung. Am 5. Juli 1942 erhielt sie die Formulare zur Vermögenserklärung, die Vorboten der Deportation. Eine Woche später war sie im Sammellager Große Hamburger Straße 26 – ein von den Nazis umfunktioniertes jüdisches Altersheim – interniert. Ihr wurde pro forma mitgeteilt, dass ihre gesamte Habe vom Staat beschlagnahmt würde. Frieda hatte nur ein bescheidenes Bankguthaben und einige Wertpapiere angeben können. Ihr Zimmerinventar plus einiger
anderweitig untergestellten Sachen wurden von einem Gutachter auf rund 1200 RM geschätzt und zum Teil von einem Althändler preiswert erstanden, zum anderen Teil versteigert. 14 Bieter ersteigerten billig diverse Gegenstände, alle namentlich in den Akten genannt.
Als dies geschah, war Frieda Dresel nicht mehr in Berlin. Am 14. Juli 1942 war sie mit 99 weiteren Opfern nach Theresienstadt deportiert worden. Angeblich war dieses „Altersghetto“ eine Stätte für einen ruhigen Lebensabend, tatsächlich handelte es sich aber um ein Durchgangslager, in dem die Menschen auf den Tod warteten, herbeigeführt entweder durch die dortigen unmenschlichen Lebensbedingungen oder durch die Ermordung in einem weiteren Vernichtungslager. Letzteres war Frieda Dresels Schicksal. Nachdem sie fast zwei Jahre Hunger, Kälte, Krankheiten und die hoffnungslose Überfüllung der Räume überlebt hatte, wurde sie am 16. Mai 1944, diesmal zusammen mit 2500 Personen, von Theresienstadt nach Auschwitz verschleppt. Sie gehörten zu den rund 7500 Menschen, die im Mai 1944 in drei „Transporten“ aus Theresienstadt weggebracht wurden, weil am 23. Juni eine internationale Kommission angekündigt war und die Wohnungen nicht so beengt aussehen sollten. Lediglich 34 der
am 16. Mai Deportierten überlebten, Frieda Dresel gehörte nicht dazu. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt.
Recherchen/Text: Micaela Haas
Stolpersteine-Initiative Charlottenburg-Wilmersdorf
Quellen:
Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Landesarchiv Berlin; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Akten der Oberfinanzdirektion; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005; www.statistik-des-holocaust.de