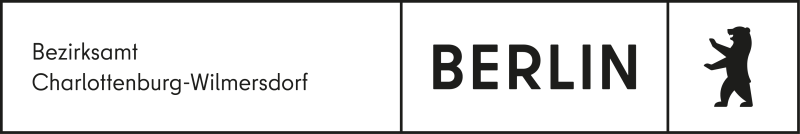HIER WOHNTE
DR. SALLY CITRON
JG. 1863
DEPORTIERT 13.8.1942
THERESIENSTADT
ERMORDET 11.9.1942
Sally Saul Citron kam am 31. März 1863 in Tremessen (poln. Trzemeszno) zur Welt. Seine Eltern waren der Kaufmann Levi Louis Citron und dessen Ehefrau Helene geb. Pulvermacher. Außer Sally hatten sie mindestens noch zwei Kinder: Hermann (Heimann), Jahrgang 1845, und Franziska, 1859 geboren. Als Sally noch keine vier Jahre alt war, zog die Familie in das nahe Gnesen (Gniezno).
Sally besuchte das königlichen Gymnasium in Gnesen, bestand Ostern 1882 das Abitur und studierte anschließend Jura in Breslau. 1887 zog er als cand. jur. nach Posen, vielleicht hatte er dort eine Referendarstelle. Er wohnte bei dem Arzt und Apotheker Moritz Citron, sicherlich ein Verwandter, denn er stammte auch aus Tremessen. Im Winter 1888/89 war Sally in Dresden, kehrte im Juli wieder zu Moritz Citron nach Posen zurück. Unklar bleibt, wann er nach Berlin ging. Als er am 11. Mai 1895 Elisabeth Heilbronn heiratete, wohnte er bereits in der Hauptstadt in der Neuen Grünstraße 25a, diesmal bei Verwandten mütterlicherseits: Max Pulvermacher und seine Mutter Dorothea. Sally und Elisabeth, genannt Else, kannten sich bereits aus Gnesen, allerdings lebte die Braut inzwischen mit ihrer verwitweten Mutter in Wiesbaden. Sally und Else nahmen eine Wohnung in der Marburger Straße 9a in Charlottenburg, wo am 6. Februar 1896 der Sohn Louis Benno zur Welt kam. Sally hatte inzwischen
promoviert und gab seinen Beruf mit Bank-Prokurist an. Er verdiente gut, und 1888 wohnte die Familie in einer vermutlich größeren Wohnung in der Pariser Straße 54. Dort wurde die Tochter Helene geboren, von allen Leni gerufen. Zwei Jahre später waren Citrons wieder umgezogen, nun in die Uhlandstraße 158.
Sallys Geschwister Hermann und Franziska waren schon seit den 70er Jahren verehelicht. Hermann hatte Florentine Harczyk aus Gnesen geheiratet, Franziska den Bruder Florentines, Ignatz Harczyk. Beide Paare waren Vettern und Kusinen: Die Mutter der Geschwister Harczyk, Johanna geb. Pulvermacher, war eine Schwester von Sallys und Franziskas Mutter Helene. Um die Jahrhundertwende lebte Hermann Citron in Berlin, ab 1907 wohnte er in der Giesebrechtstraße 19. Ein Jahr zuvor hatte Ignatz Harczyk, der bis dahin Gymnasialprofessor in Breslau gewesen war, mit Franziska eine Wohnung in der Giesebrechtstraße 18 bezogen.
Auch Sally war inzwischen mehrmals umgezogen, vermutlich in immer repräsentativere Wohnungen, denn beruflich war er recht erfolgreich. Er war schon länger Prokurist bei der Bank William Rosenheim & Co., als er 1920 als Gesellschafter in sie eintrat. Fortan nannte er sich Bankier. Zudem war er Prokurist und einer der Direktoren der Berliner Handelsgesellschaft (BHG). Diese war Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden und widmete sich nach wie vor der Industriefinanzierung. Sie war besonders mit großen Unternehmen wie AEG verbunden. Ihr Hauptgebäude in der Behrensstraße 32 ist heute Sitz der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
1930 wurde die BHG eine der Hauptkommanditisten von William Rosenheim & Co, drei Jahre später schied sie allerdings wieder aus. Da war Sally Citron schon seit einem Jahr ebenfalls ausgeschieden. Inhaber wurde ein Max Berger und 1939 wurde das Haus in Bankgesellschaft Berger & Co umbenannt. Dafür musste Max Berger bestätigen, dass er „im Sinne der Nürnberger Gesetze” Reichsbürger sei.
Seit 1926 war Sally Citron auch Hauptgesellschafter der 1923 gegründeten Tuchgroßhandlung Rothe, Büdel & Rickel in der Roßstraße 21. Er blieb es auch noch im Ruhestand bis 1938, als die nichtjüdische Firma Schulze & Neubauer das Geschäft übernahm.
Als Sallys Tochter Leni 1923 den praktischen Arzt Dr. Fritz Blumenthal heiratete, wohnte Familie Citron in der Teplitzer Straße 32, Grunewald. Sohn Louis hatte Physik studiert, war inzwischen auch verheiratet und nach Jena gezogen. 1931 siedelte er mit seiner Frau Anna geb. Apel und den zwei Söhnen in die Schweiz um. Drei Jahre zuvor hatte Sally ein schwerer Schlag ereilt: Else, seine Frau, starb „nach kurzer Krankheit” am 19. Februar 1928 in Oberstdorf im Allgäu. Wahrscheinlich hatte sich das Ehepaar dort zur Kur aufgehalten. Sechs Jahre später traf die Familie ein weiteres Unglück: Louis verunglückte tödlich in den Schweizer Bergen.
1933 ging Sally in den Ruhestand, von der Berliner Handelsgesellschaft erhielt er eine Pension von 1000 RM im Monat, die ihm bereits 1924 vertraglich zugesichert worden war, zuzüglich eines Ruhegeldes von 1667,70 RM jährlich. Er nahm sich nun eine Wohnung drei Straßen weiter in der Franzensbader Straße 2. Mit ihm wohnte als Hausdame – vielleicht auch schon vorher in der Teplitzer Straße – Wilhelmine Wolfstein, genannt Elli, eine Schwester der bekannten Sozialistin und Kommunistin Rosi Wolfstein, die u.a. zusammen mit ihrem späteren Mann Paul Frölich den Nachlass Rosa Luxemburgs verwaltete und deren Biografie schrieb.
Sallys Ruhestand fiel mit der Machtübernahme Hitlers zusammen und wurde denkbar unruhig. Juden wurden zunehmend diskriminiert und eingeschränkt. Sallys Pension wurde zwar weiter ausgezahlt, er hatte aber 15% als soziale Ausgleichsabgabe zu leisten, ab Ende 1938 konnte er gar nicht mehr über sein Vermögen verfügen: Am 12. November 1938, unmittelbar nach den Novemberpogromen, wurde die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ erlassen, nach der Juden nur noch von einem „beschränkt verfügbaren Sicherheitskonto“ durch „Sicherungsanordnung“ festgelegte Beträge für ein Existenzminimum abheben durften.
Nach den Pogromen steigerten sich die antijüdischen Maßnahmen rasant und Sallys Tochter Leni und ihr Mann Fritz Blumenthal entschlossen sich zur Emigration in die USA über Schottland. Lenis Schwiegervater Hermann Blumenthal, der bis dahin bei ihnen gewohnt hatte, zog zu Sally in die Franzensbader Straße. Bald wurde Sally jedoch genötigt, seine Wohnung aufzugeben um für Nichtjuden Platz zu machen. Alle drei, Sally, Hermann Blumenthal und Elli Wolfstein fanden Unterkunft in der Giesebrechtstraße 18, Sally bei seiner inzwischen verwitweten Schwester Franziska Harczyk, Elli und Hermann vermutlich auch. Hermann Blumenthal musste allerdings zum 1. April 1941 die Giesebrechtstraße verlassen und wurde in der Württembergische Straße bei Henriette Jacob eingewiesen.
Im August 1942 wurden Sally und Franziska in das Sammellager in der Großen Hamburger 26 gebracht, ein von der Gestapo umfunktioniertes jüdisches Altenheim, und am 13. August nach Theresienstadt deportiert. In dem angeblichen „Altersghetto” dort herrschten kaum bessere Bedingungen als in anderen Konzentrationslagern. Unzureichende Ernährung, hoffnungslose Überfüllung, Kälte, Hunger und schreckliche hygienische Zustände sorgten für Krankheiten und Seuchen und kosteten zahlreichen Insassen das Leben. Und wer überlebte, wurde über kurz oder lang in ein Vernichtungslager weiterdeportiert. Sally und Franziska hielten es nicht lange durch: Sally starb bereits am 11. September 1942, Franziska überlebte ihn um ganze 11 Tage – am 22. September verschied auch sie, offiziell an Altersschwäche, Sally an Harnvergiftung. Die Todesangaben aus dem Lager verschleiern jedoch sämtlich, dass die eigentlichen Ursachen die katastrophalen Lebensumstände im Ghetto waren.
Hermann Blumenthal war zwei Tage vor den Geschwistern Citron, am 11. August 1942, ebenfalls nach Theresienstadt deportiert worden. Vielleicht gelang es ihm, seine Verwandten dort in dem vorherrschenden Chaos zu finden und noch einmal zu sehen. Er wurde kurz nach Franziskas Tod am 26. September 1942 nach Treblinka weiterverschleppt und dort ermordet.
Elli Wolfstein, die nach Franziskas Deportation weiterhin in der Giesebrechtstraße 18 wohnte – nun bei der Familie Schlesinger – wurde am 29. Januar 1943 nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht.
Quellen:
Gedenkbuch, Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Landesarchiv Berlin; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Arolsen Archives; https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/; Königlich-Preußischer Staatsanzeiger 1867 (https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10486498/bsb:4173804?queries=Citron&language=de&c=default”:https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10486498/bsb:4173804?queries=Citron&language=de&c=default); Einwohnermeldekartei Posen (http://e-kartoteka.net/en/); Deportationslisten (https://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger.html)
Recherchen/Text: Micaela Haas
Stolpersteininitiative Charlottenburg-Wilmersdorf