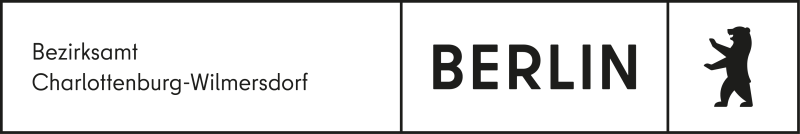HIER WOHNTE
IDA INGEBORG
MEINHARDT
JG. 1893
DEPORTIERT 25.1.1942
RIGA
ERMORDET NOV. 1942
Am 19. Mai 1893 kam Ida Ingeborg in Schwedt/Oder zur Welt. Sie war die Tochter des Pferdehändlers Max Meinhardt und seiner Frau Dine Dorchen geb. Schulvater, genannt Toni, aus Berlin. Ida Ingeborg hatte eine Halbschwester, Ilse, aus der ersten Ehe ihres Vaters mit Ida geb. Tucholsky, eine Tante des Schriftstellers Kurt Tucholsky. Diese war 1890 gestorben, als ihre Tochter noch nicht ganz 3 Jahre alt war. Daher ist es gut möglich, dass Ilse nicht bei dem verwitweten Vater blieb, sondern bei Verwandten aufwuchs. Zwei Jahre später heiratete Max Meinhardt Dine Dorchen Schulvater.
Max Meinhardt stammte aus dem nahe gelegenen Vierraden (seit 2003 zu Schwedt eingemeindet), wo sein Großvater Gumpel Lewin sich im 19. Jahrhundert, aus Tütz (heute Tuczno) in Westpommern kommend, niederließ. In Vierraden und Schwedt gab es bedeutende jüdische Gemeinden, die eng miteinander verbunden waren.
Ida Ingeborg – in Dokumenten mal nur Ida genannt, mal nur Ingeborg – hatte zunächst ein ähnliches Schicksal wie ihre Halbschwester Ilse: Am 21. September 1895, Ida war 3 Jahre alt, starb ihre Mutter. Max Meinhardt heiratete noch einmal am 17. März 1898, die Braut war Rosa geb. Wollstein. Mit ihr hatte er einen Sohn, Fritz Aron, geboren 1899, also hatte Ida Ingeborg auch einen Halbbruder.
Die Beziehungen der Familie zu Berlin – auch Rosa kam aus der Hauptstadt – waren vermutlich eng und so wundert es nicht, dass Ida dort an der Höheren Handelsschule des Lettevereins eine Ausbildung zur Sekretärin machte. Sie blieb ledig, und konnte sich mit ihrem Beruf den Lebensunterhalt sichern. Wir wissen aber nicht, wo sie sich niederließ und wann sie nach Berlin kam. 1920 starb ihr Vater in Schwedt, Bruder Fritz verließ die Stadt nach dem Krieg, er ging zunächst nach Guben, dann nach Danzig, schließlich nach Dresden. Idas Stiefmutter Rosa folgte Fritz nach Dresden. Vielleicht war dies der Zeitpunkt, an dem auch Ida von Schwedt wegging.
In Berlin hatte Ida allerdings keine eigene Wohnung, in den Adressbüchern wird sie nicht aufgeführt. Wir finden sie erst in der „Ergänzungskartei“ zu der Volkszählung vom 17. Mai 1939, in der Juden getrennt erfasst wurden. Dort ist Ida Meinhardt als Untermieterin von Heinrich Michelson in der Giesebrechtstraße 13 registriert. Gleichzeitig war sie aber auch in der Nürnberger Straße 66 eingetragen. Da dieses Haus der Jüdischen Gemeinde Berlin gehörte, hatte sie dort vielleicht eine zweite Unterkunft. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie als Sekretärin für die Gemeinde arbeitete und in diesem Zusammenhang dort auch gezählt wurde. 1940 wurde Heinrich Michelson genötigt, seine Wohnung aufzugeben, um Wohnraum für Nichtjuden freizumachen. Es ist anzunehmen, dass auch seine Untermieterinnen, Julia Ehrlich und Ida Meinhardt gezwungen waren umzuziehen.
Juden hatten mittlerweile keine Mieterrechte mehr, und Ida wurde in ein – sicherlich kleineres – Zimmer in der Kurfürstenstraße 115, bei Paula Mühsam eingewiesen. Die Entrechtung und Demütigung von Juden, die bereits 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begonnen hatte, nahm nach den Pogromen vom November 1938 drastisch zu. Eine Flut von Verordnungen zielte auf die Ausgrenzung von Juden aus dem öffentlichen Leben: Sie durften nicht mehr in Theater, Konzerte, Kinos usw. gehen, zu bestimmten Zeiten durften sie gar nicht auf die Straße, durften nur von 4 bis 5 Uhr nachmittags einkaufen. Alle Wertgegenstände mussten sie abliefern, Rundfunkgeräte wurden beschlagnahmt, Telefonanschlüsse gekündigt. Ihre Konten wurde zu „Sicherheitskonten“ erklärt, von denen sie nur durch „Sicherungsanordnung“ festgelegte Beträge für ein Existenzminimum abheben durften. Sie hatten ihrem Namen den Namen „Sara“ oder „Israel“ als Kennzeichnung
hinzuzufügen, ab September 1941 mussten sie zudem den Judenstern tragen. Im Oktober 1941 begannen die Deportationen, gleichzeitig wurde die – ursprünglich erwünschte – Auswanderung von Juden verboten.
Von der Kurfürstenstraße 115 holte man Ida Meinhardt im Januar 1942 ab und brachte sie zunächst in die zum Sammellager umfunktionierte Synagoge in der Levetzowstraße 7/8. Von dort aus wurde sie am 25. Januar, wenige Tage nach ihrer ehemaligen Mitbewohnerin Julia Ehrlich, mit rund 1000 weiteren Menschen nach Riga deportiert. Die 5-tägige Fahrt fand bei klirrender Kälte in Güterwagen statt und viele Insassen überlebten sie nicht. Ob Ida Ingeborg Meinhardt schon vor Ankunft in Riga erfror, dort gleich erschossen wurde, oder noch in das Rigaer Ghetto gelangte, ist nicht ganz klar. Eine Quelle gibt als Todesdatum November 1942 an, dies könnte aber auch das Datum sein, zu dem sie später für tot erklärt wurde. Sollte sie noch so lange im Ghetto überlebt haben, so hatte sie dort katastrophale und menschenunwürdige Lebensbedingungen zu erleiden – Überfüllung, Kälte, Hunger, zahlreiche Krankheiten und mitunter auch harte Zwangsarbeit führten zum Tod der allermeisten
Bewohner. Aus Idas Zug überlebten nur 13 Menschen, Ida Meinhardt gehörte nicht zu ihnen.
Idas Halbbruder Fritz, seit 1924 in Dresden, war der Kommunistischen Partei beigetreten und als Arbeiterfunktionär und später auch im Untergrund politisch tätig. Er wurde gleich 1933 verhaftet, nach 4 Monaten aber wieder freigelassen. Durch seine nichtjüdische Ehefrau geschützt, musste er später dennoch Zwangsarbeit leisten, unter anderem in der „Heilkräuter- und Teefabrik Willy Schlüter“, in der auch der Schriftsteller Viktor Klemperer arbeiten musste. Im April 1943 wurde Fritz Meinhardt wegen einer abfälligen Bemerkung zu dem Essen für Zwangsarbeiter an Hitlers Geburtstag denunziert und tags darauf verhaftet. Nach zwei Tagen im Polizeigefängnis fand er am 23. April 1943 dort den Tod – laut Einäscherungsregister durch Erhängen. In seinen Tagebüchern erwähnt Viktor Klemperer die Beisetzung der Urne am 3. Mai. Für Fritz Meinhardt liegt ein Stolperstein in Dresden, in der nach ihm benannten Straße, vor der Nr. 22.
Ilse Meinhardt hingegen, Idas Halbschwester, konnte mit ihrem Mann Robert Neumann schon früh nach Italien fliehen. Robert Neumann starb jedoch 1937 in Mailand und Ilse emigrierte über die Schweiz in die USA. Dort starb aber auch sie kurz darauf, am 14. August 1940 in Los Angeles.
Quellen:
Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Landesarchiv Berlin; Stadtmuseum Schwedt/Oder; zu Ida Tucholsky: Bettina Müller, „Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle“, Tucholsky-Gesellschaft, Rundbrief 2/2018; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005; zu Fritz Meinhardt
Recherchen/Text: Micaela Haas
Stolpersteininitiative Charlottenburg-Wilmersdorf