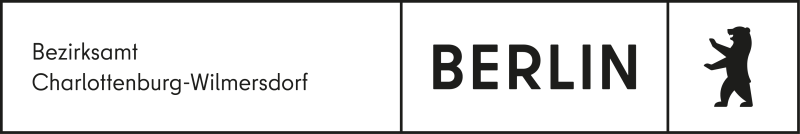Julius Liepmann wurde am 17. Januar 1869 in Neustadt-Eberswalde, Brandenburg, als Sohn des Kaufmanns Joseph Liepmann geboren. Erst ab 1877 hieß die Stadt nur Eberswalde. Das Adressbuch von 1890 verzeichnet mehrere Kaufleute Liepmann, auch einen Joseph Liepmann, Rentier, und eine Firma Joseph Liepmann, Inhaber Gustav Liepman. Die Vermutung liegt nahe, dass sie alle miteinander verwandt waren, unklar nur, in welchem Verhältnis. Sicher ist nur, dass Julius einen Bruder namens Oskar hatte, mit dem zusammen er in Chemnitz um 1897 die Firma „Gebrüder Liepmann, Kurzwaren und Posamenten“ gründete. Zuvor hatte er eine kaufmännische Ausbildung in Breslau absolviert. (Posamente sind Dekorationsborten, Spitzen, Quaste und ähnliches).
Im März 1903 heiratete Julius in Spandau Margarete Heymann, genannt Grete. In Spandau – damals noch nicht zu Berlin gehörend – war Grete am 11. Juni 1875 zur Welt gekommen. Ihr Vater Isidor Heymann war ebenfalls Kaufmann, die Mutter Emma eine geborene Seliger. Margarete hatte zwei Geschwister, Max und Anna. Isidor Heymann handelte vielleicht in der gleichen Branche wie Julius und Oskar Liepmann, und Margarete und Julius lernten sich dadurch kennen. Das Paar lebte zunächst in Chemnitz, Stephanplatz 2. Am 18. Februar 1904 kam dort ihre Tochter Ilse Johanna zur Welt.
Ein Jahr darauf sind die Gebrüder Liepmann mit ihrer Firma in Berlin zu finden, im 3. Hinterhof der Neuen Friedrichstraße 4. Oskar bezog eine Wohnung in der Klopstockstraße 31, Julius in der Flotowstraße 1. 1910 zog Julius mit seiner Familie an das Hansaufer 8, fünf Jahre später wurde auch die Firma verlagert, in die Kommandantenstraße 10/11. Vermutlich waren beides Verbesserungen. 1927 allerdings war das Lokal in der Kommandantenstraße aufgegeben, die Firma unter Julius’ Adresse eingetragen und Oskar nur noch als Kaufmann oder Vertreter aufgeführt. 1930 scheint auch die Firma aufgelöst gewesen zu sein, nun wurde Julius ebenfalls lediglich als Vertreter im Adressbuch verzeichnet. Ein Jahr später zogen Julius und Margarete in die Geisenheimer Straße 13a. Sie waren inzwischen längst Großeltern, Tochter Ilse hatte 1926 den Prokuristen Alfred Adler geheiratet und im April 1928 ihren ersten Sohn, Rolf, zur Welt gebracht. Adlers wohnten zunächst in der Wilmersdorfer
Kaiserallee 30 (heute Bundesallee), später in der Zähringerstraße 25. Im September 1930 kam Ilses zweiter Sohn Stefan zur Welt.
1936 – Lebensbedingungen für Juden unter der NS-Regierung waren schon recht schwierig geworden – zogen Julius und Margarete in die Schlüterstraße 41, folgt man dem Adressbuch, für ein oder zwei Jahre. Rätselhafterweise findet sich im Adressbuch ab 1938 ein Moritz Liepmann in der Bleibtreustraße 33 und kein Julius, später im Straßenverzeichnis aber auch Julius in der Bleibtreustraße 33. Die Vermutung liegt nahe, dass, aus welchem Grunde auch immer, Julius sich als Moritz – vielleicht sein zweiter Vorname? – eintragen ließ. Demnach wären Liepmanns 1937 in die Bleibtreustraße 33 gezogen.
In diesem Jahr muss es für einen selbständigen jüdischen Vertreter schon schwierig gewesen sein, für seinen und seiner Frau Lebensunterhalt zu sorgen. Ein Höhepunkt der Diskriminierung und Verfolgung von Juden wurde dann die Zeit nach den Pogromen vom November 1938. In kurzer Folge wurden Verordnungen erlassen, die Juden vollständig aus dem wirtschaftlichen und öffentlichen Leben ausschalten sollten. Schwiegersohn Alfred Adler wurde nach dem Pogrom in Sachsenhausen inhaftiert und dort so misshandelt, dass er im Dezember 1938 als arbeitsunfähig entlassen wurde. Wie andere verpflichtet seine Auswanderung zu betreiben, gelang es ihm, im April 1939 nach England zu emigrieren, im Mai 1939 folgte Ilse mit ihrem elfjährigen Sohn Rolf – später Ralph genannt. Der jüngere Stefan war schon im März des Jahres mit einem Kindertransport nach England gelangt.
Julius und Margarete konnten jedoch nicht flüchten. Sie blieben der weiteren Diskriminierung und Demütigung ausgesetzt. Besuch von öffentlichen Veranstaltungen wie Theater, Kino u.ä. war ihnen verboten, Verkehrsmittel konnten sie nur beschränkt benutzen, sie durften zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Bannbezirken nicht auf die Straße, nur von 4 bis 5 Uhr nachmittags war ihnen erlaubt einzukaufen, und vieles mehr – Wertgegenstände mussten sie abliefern, Rundfunkgeräte wurden beschlagnahmt, Telefonanschlüsse gekündigt. Ab 19. September 1941 mussten sie den Judenstern tragen.
Im August 1942 hatten sie eine „Vermögenserklärung“ auszufüllen, da sie zur „Abwanderung“ oder „Evakuierung“ bestimmt seien – Euphemismen für die Deportation. Wahrscheinlich wurde ihnen, die bereits 75 und 67 Jahre alt waren, gesagt, sie würden in das „Altersghetto“ Theresienstadt kommen, noch ein Euphemismus, hier für das völlig menschenunwürdige Lager dort. Eine Nachricht konnten sie noch über das Rote Kreuz an ihre Tochter schicken: „Geliebte Kinder und Enkel. Eurerseits nachrichtslos. Verlassen Berlin, sind völlig gesund. Gedenken Eurer innigster Liebe. Bleibt gesund. Schreibt Lotte. Wünschen Euch alles Gute. Grüsse Eltern“. Dies sollte das letzte Lebenszeichen sein.
Lotte, das war Elisabeth Heymann, die nichtjüdische Ehefrau von Margaretes Bruder Max. Ebenfalls über das Rote Kreuz schrieb sie am 3. September 1942: „Eltern verließen Berlin nach Theresienstadt … Vielleicht Eurerseits Unterstützung zulässig“.
Tatsächlich stehen ihre Namen auf einer Liste für die Deportation nach Theresienstadt am 14. August. Offenbar wurde aber kurzfristig umdisponiert. Margarete und Julius Liepmann gehören zu den 63 Menschen, die zwar ursprünglich für Theresienstadt bestimmt waren, aber dann willkürlich zu einem „Transport“ nach Riga am 15. August kamen – wahrscheinlich aus dem zynischen Grund, dass die für letzteren vorgesehene Zahl von 1000 Opfern sonst nicht erreicht worden wäre. Tatsächlich wurden mit diesem Zug 1004 Menschen deportiert.
Der Zug erreichte Riga am 18. August 1942. Die meisten der bereits Ende 1941/Anfang 1942 nach Riga Deportierten waren in das Ghetto Riga eingeliefert worden, wo unsäglich schlechten Bedingungen herrschten. Doch nun war gar nicht mehr vorgesehen, die Menschen in das Ghetto zu bringen. Sämtliche Insassen des Zuges – bis auf eine Frau, die Krankenschwester war – wurden kurz nach der Ankunft am Bahnhof Riga-Skirotava in den umliegenden Wäldern von Rumbula und Bikernieki ermordet, auch Margarete und Julius Liepmann. Der 18. August 1942 war ihr Todestag.
Fast ein Jahr später, am 4. Juli 1943, schrieb Max Heymann an seine Nichte Ilse Adler, wieder per Rotes Kreuz: „Empfing Euern Januar Rotkreuzbrief.- Von Julius, Grete keine Nachrichten.- Correspondieren Eva regelmäßig Rotkreuz, ebenso neuerdings Maximilianos.- Innigste Grüße Onkel Max Tante Lotte“. Eva war die Tochter von Max und Lotte, die, wie Stefan Adler, mit einem Kindertransport nach England ausreisen konnte. Mit „Maximilianos“ ist vermutlich die Familie von Margaretes Schwester Anna gemeint, der mit ihrem zweiten Mann, Max Lipstein, 1939 die Flucht nach Kolumbien gelang. Max Heymann jedoch entkam nicht. Er wurde am 23. Februar 1944 nach Theresienstadt deportiert und starb dort wenige Tage nach Ankunft am 27. Februar 1944.
Ilse Adler, Margaretes und Julius’ Tochter, wanderte 1940 mit Mann und Söhnen weiter in die USA. Oskar Liepmann, Julius’ Bruder, ist in keiner Opferliste aufgeführt, so dass man hoffen kann, dass er den NS-Schergen entkommen konnte. Margaretes Nichte Eva ging nach dem Krieg nach Baltimore, studierte Musik und wurde Opernsängerin. Ihre Mutter Elisabeth Heymann fuhr 1950 auch in die USA und starb 1954 in Pittsburgh. Eva kehrte nach Deutschland zurück und heiratete den Orchesterdirigenten Frithjof Haas.
Recherchen, Texte: Micaela Haas.
Quellen: Gedenkbuch. Bundesarchiv Koblenz, 2006; Gedenkbuch Berlin der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 1995; Berliner Adressbücher; Landesarchiv Berlin; Akten des Landesentschädigungsamtes Berlin; Gottwaldt/Schulle, Die „Judendeportationen“ aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005; Yad Vashem, Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer; Angaben von Stephen Adler