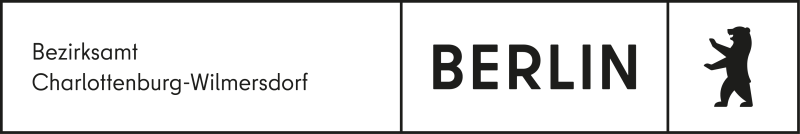HIER WOHNTE
MARIA LOEBINGER
GEB. HELLER
JG. 1907
DEPORTIERT 1.7.1943
THERESIENSTADT
1944 AUSCHWITZ
BERGEN – BELSEN
SALZWEDEL
BEFREIT
Maria Heller wurde am 28. Oktober 1907 in Lodz /Polen geboren. Ihre Eltern waren Julius Heller (gestorben 1933) und Paula Heller geb. Muszkat (gestorben 1930). Sie war das einzige Kind. Warum und wann ihre Eltern mit ihr nach Berlin gekommen sind, ist nicht bekannt. Beide Eltern gehörten der jüdischen Gemeinde in Berlin an.
Maria wuchs in Berlin auf. Nach der Reifeprüfung wollte sie gern Mode- und Reklamezeichnerin werden. Sie besuchte die Reimannschule, eine private Kunst-und Kunstgewerbeschule in der Landshuter Str. 38 in Berlin – Schöneberg. Die Vermögensverluste ihres Vaters in der Inflationszeit zwangen sie jedoch dazu, eine Ausbildung zu machen, um auf eigenen Füßen zu stehen. Sie wurde Sekretärin und Stenotypistin, lernte Fremdsprachen.
Sie fand eine Anstellung als Sekretärin und Statistikerin im „Fachausschuss für Fleischversorgung e.V.“ (eine Interessenvertretung der Fett-und Gefrierfleisch-Importeure). Im September 1930 starb ganz plötzlich ihre Mutter, im Januar 1933 ihr Vater.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlor sie ihre Arbeit: Sie war als Jüdin nicht mehr tragbar.
1931 lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Dr. Günther Loebinger kennen. Sie heirateten am 19. August 1937.
Dr. Günther Loebinger war zu diesem Zeitpunkt in der renommierten Anwaltskanzlei von Dr. Hans-Fritz Abraham in der Friedrichstraße tätig – eine auf Hypotheken-und Aufwertungswesen spezialisierte Kanzlei. In der Folge der reichsweiten Boykotte jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte musste er aus der Kanzlei ausscheiden. Als ehemaliger Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg „durfte“ er noch als Rechtsanwalt zugelassen bleiben und eröffnete eine eigene Kanzlei. Maria half ihm und unterstützte ihn dabei, Juden rechtlich zu vertreten und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen – obwohl es – wie sie schrieb – ein aussichtsloses Unterfangen war.
Als ihr Mann während des Novemberpogroms am 9. November 1938 verhaftet und ins KZ Sachsenhausen verschleppt wurde, bangte sie um sein Leben. Am 2. Dezember 1938 wurde ihr Mann aus der Haft entlassen. Er befand sich in einem furchtbaren Zustand. Sie suchten verzweifelt nach Fluchtwegen. Ihre Not wurde von skrupellosen Menschen ausgenutzt, die sich Vorauszahlungen geben ließen und sich nie wieder meldeten. Endlich gab es eine Hoffnung: Im Sommer 1939 erreichte ihr Onkel Paul – der Bruder ihres Vaters, der in England lebt -, dass sie ein Permit von dort erhielten. Doch dann machte der Ausbruch des Krieges mit dem Überfall der Nazis auf Polen auch diese Hoffnung zunichte.
Nach verzweifelten Jahren vergeblicher Fluchtversuche, ständiger Angst vor Verhaftung und Deportation beschlossen sie unterzutauchen. Am Tag vor der geplanten Flucht in die Illegalität – sie hatten in einem südlichen Vorort Berlins ein Versteck gefunden – wurden sie am 18. Juni 1943 (Maria datiert die Verhaftung auf den 17. Juni) von einer „Horde“ von Abholern – wie Maria schreibt – verhaftet und in das Sammellager Große Hamburger Straße gebracht. Dass sie in dieser aussichtslosen Lage versuchten, in den Tod zu flüchten, deutete Maria nur an; ihre Versuche werden vereitelt.
Am 1. Juli 1943 wurden sie mit dem 94. Alterstransport (Welle 57) nach Theresienstadt deportiert – eine „Bevorzugung“ wegen der besonderen Kriegsauszeichnung ihres Mannes, wie Maria schrieb.
Nach mehr als einem Jahr wurden sie von dort aus am 28.10.1944 mit dem letzten „Herbsttransport“ nach Auschwitz deportiert (Bezeichnung „Ev -“ ; Ankunft 30.10.1944, Günther Loebinger hat die Transportnummer 1332, Maria die Transportnummer 1333).
An der Rampe von Auschwitz sah Maria ihren Mann zum letzten Mal.
Sie blieb ca. 6 Tage in Auschwitz – Tage in denen sie drei Mal Selektionen erlebte. „Einmal stand ich 16 Stunden Appell ohne Strümpfe oder Unterwäsche im eisigen Wind.“ Auschwitz war damals – so Maria – bereits in Auflösung begriffen. Die Kriegsfront rückte näher. „Diejenigen von uns, die nicht in den rauchenden Krematorien endeten, wurden nach 6 Tagen weiterverfrachtet. Mein Transport in dem schon bekannten Viehwagen ging nach Bergen-Belsen.“ Am 6. November 1944 ging ein Transport mit Frauen nach Bergen-Belsen.
Dort wurden sie mitten im Winter in Zelten untergebracht, „zusammengepfercht auf verfaultem Stroh“. Die Zelte konnten nicht einmal den nötigsten Schutz vor Regen, Sturm und Kälte bieten und stürzten sofort ein. Es herrschten katastrophale Zustände.
Am 15. Dezember 1944 ging ein Transport von 200 Frauen von Bergen-Belsen nach Salzwedel ab, einem Lager, das dem Lager Neuengamme bei Hamburg unterstand. Dort musste Maria in langen Schichten in einer Munitionsfabrik Zwangsarbeit leisten – bei zwei Scheiben Brot und einer Wassersuppe am Tag. Die Frauen waren abgemagert bis auf die Knochen, zeigten Hungerödeme; waren auch hier immer wieder von Selektionen bedroht. „Jeder abschätzende Blick der SS-Aufseherinnen war eine Todesdrohung. Zweimal wurden Transporte mit den Arbeitsunfähigsten zusammengestellt und mit uns unbekanntem Ziel fortgeschickt.“
Am 14. April 1945 wurde sie von der US-Armee befreit.
Lange hoffte sie darauf, ihren Mann wiederzufinden – vergeblich. Bis auf den Onkel in England hatte sie keine Angehörigen mehr. Ihre Cousine Edith Muszkat, die auch in Berlin lebte, flüchtete im Jahre 1943, als ihre Deportation bevorstand, in den Tod.
„Die ganze Zeit hatte mich nur die Hoffnung, meinen Mann wiederzusehen, aufrechterhalten. Auch noch die ersten Monate in Berlin, als ich die Wahrheit in ihrem ganzen grausigen Ausmaß erfuhr, ….wollte und wollte ich die Hoffnung nicht aufgeben. Ich fand niemanden von meinen Verwandten am Leben vor. Ich hatte keinen, der mir nahestand. Erst nach drei Jahren wurde mir die Erlaubnis zuteil, meinen einzigen überlebenden Verwandten, meinen alten Onkel Paul“ in London aufzusuchen.
Am 30. August 1948 konnte sie nach England auswandern. Ihr Onkel starb im Februar 1950. Sie übernahm Gelegenheitsarbeiten, arbeitete als Hausangestellte, als Übersetzerin, Korrespondentin, war aber durch die furchtbaren Erlebnisse körperlich und seelisch so gezeichnet, dass sie nicht mehr arbeiten konnte.
In den Entschädigungsakten befand sich ein Lebenslauf vom Januar 1952 von Maria Loebinger. Die folgenden Passagen sprechen für sich:
„Ich habe durch die nazistische Barbarei alles verloren: meinen geliebten Mann, meine Gesundheit, meinen Verwandten- und Freundeskreis, mein Heim, meine soziale Stellung, mein Vermögen und gesichertes Einkommen, meinen Schmuck und Bücher, all die unersetzlichen Erinnerungswerte, wie Bilder, Fotos, Briefe, meinen Glauben an die Menschheit und 18 Jahre meines Lebens. Ich habe kein Bild meiner Eltern zurückbehalten (ein, das letzte, das ich in Auschwitz in meiner Hand zu verstecken versuchte, wurde von einer Aufseherin zerrissen und fortgeworfen), und nur durch Zufall eine Momentaufnahme meines Mannes gefunden. (…) Es gibt keine Summe, die mich für das entschädigen könnte, was ich durchlebt habe, für die Hölle, durch die ich gegangen bin, für den Verlust meines Mannes. Die Bilder, die sich meinem Gedächtnis für immer eingeprägt haben, können nie vergessen werden.“
Recherche und Text: Margit Nowak
Quellen:
• Gedenkbuch Bundesarchiv
• Berliner Adressbücher
• Jüdische Adressbücher 1929/30 ; 1931/ 32
• Yad Vashem, The Central Database of Shoah Victims’ Names und Gedenkblätter
• Arolsen Archives, International Tracing Service (IST), Bad Arolsen
• Berliner Landesarchiv
• Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
• Landesamt für Bürger-und Ordnungsangelegenheiten, Entschädigungsbehörde Opfer des Nationalsozialismus
• Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam
• Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum Archiv
Oranienburger Str. 28-30 ,10117 Berlin
• KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen
• KZ-Gedenkstätte Neuengamme