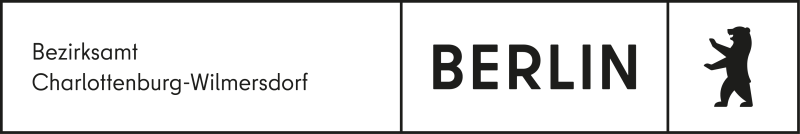In diesem Haus hat Johanna Moosdorf mehr als 40 Jahre gelebt – Leben bedeutete für sie schreiben. Als Jugendliche hatte sie sich an Käthe Kollwitz gewandt, ihr Proben ihres Schreibens und ihres bildnerischen Schaffens geschickt und um Rat gefragt: ,Soll ich eher Schriftstellerin oder Malerin werden?’ Käthe Kollwitz riet ihr zum Schreiben. Doch als der erste Gedichtband 1933 in Druck gehen sollte, wurde die Veröffentlichung verboten, weil sie kurz zuvor einen Juden geheiratet hatte, Paul Bernstein. Johanna Moosdorf schrieb dennoch weiter, und schon 1946 erschien der Gedichtband “Brennendes Leben”, 1947 folgte der Roman “Bildnis”. Ihre Lesungen waren gut besucht, und das Schauspiel “Schneesturm in Worotschen” wurde mit großem Erfolg aufgeführt. Sie war kurz vor Ende des Krieges nach Leipzig, ihrer Geburtsstadt, zurückgekehrt, dort übernahm sie 1947 die Chefredaktion der literarischen Zeitschrift “März”. Doch schon
nach der vierten Nummer wurde wieder ein Verbot ausgesprochen: Die Zeitschrift musste 1948 wegen “westlerischer und kosmopolitischer Tendenzen” eingestellt werden. Johanna Moosdorf ließ sich in ihrer literarischen Standortbestimmung nicht irritieren. Sie beschreibt ihre Haltung folgendermaßen: “Das Engagiertsein ist für mich eine Gegebenheit, ich engagiere mich nicht, und ich werde nicht engagiert: ich bin engagiert – allerdings in einem weiten Sinne, engagiert für den Menschen.” (“Vom Engagement des Schriftstellers”, in Johanna Moosdorf. Nelly-Sachs-Preisträgerin Dortmund 1963, hrsg. von der Stadtbücherei Dortmund 1965, S.15).
Sie hat trotz des Verbots unbeirrt weiter geschrieben und veröffentlicht. Aufgrund eines Hinweises auf drohende politische Verfolgung verließ sie 1950 die Stadt Leipzig, ging mit ihren beiden Kindern, Tom und Barbara Bernstein, nach Westberlin, stand wieder vor einem Neubeginn, weiter dem Schreiben verpflichtet. 1959 zog sie hier, Kastanienallee 27, in den 2. Stock des Vorderhauses. Eine kleine Passage aus dem autobiographisch geprägten Roman “Jahrhundertträume” mag einen Eindruck geben von dem Gefühl, sich eine Bleibe geschaffen zu haben: “In ihrem neu erworbenen, solide gemauerten Domizil… darf sie ungestört lesen, schreiben, nachdenken.” (Jahrhundertträume, S. 9). Und ein paar Zeilen weiter heißt es von der Hauptfigur: “Inzwischen sind ein paar Tage vergangen, aber Jenny ist mit dem Einräumen noch immer nicht fertig. Gewöhnlich bringt sie dergleichen schnell hinter sich, jetzt nimmt sie sich, besonders für das Auspacken der
Bücherkisten, viel Zeit. Sie will die Bücher ordentlich in die Regale stellen, hier Lyrik und Dramen, dort Romane, Novellen, Essays, in einem dritten Fach Philosophie und Geschichte. Keinesfalls soll es wieder ein Durcheinander geben, eine Sucherei: Wo steht mein ,Malte’, wo ,die Droste’ ?” (ebd., S. 10).
Sie arbeitete hier in Westend mehr als 40 Jahre. Es gab verschiedene Versuche, sie zum Umzug zu bewegen: Ihre Kinder waren in die USA ausgewandert und bemühten sich vergeblich, sie zum Nachziehen zu bewegen. Eine große Umzugskiste aus Holz war schon angeschafft für den Transport über den Atlantik – sie fand sich nach dem Tod Johanna Moosdorfs noch im Keller und diente nun der Tochter zum Verschicken von Teilen des Nachlasses, auch ihrer eigenen frühen Bilder, denn die Tochter lebt als Malerin in den Vereinigten Staaten, führt so die eine Linie der Begabungen ihrer Mutter fort. Mitte der 90er Jahre gab es ein weiteres wohlmeinendes Angebot: Ein befreundetes Arztehepaar aus Niedersachsen hatte ihr ein Zimmer im Haus freigehalten, damit sie dort – medizinisch und auch sonst gut versorgt – ihren Lebensabend verbringen könne. Die Vernunft schien dafür zu sprechen, Johanna Moosdorf fiel die Absage schwer. Sie konnte sich nicht vorstellen, ohne die ihr vertraute Umgebung weiter schreiben zu können. Sie liebte die Mondnächte, in denen sie dem wandernden Mond – ,der Mondin’, wie sie sagte – von Fenster zu Fenster innerhalb ihrer Wohnung folgte und Zwiesprache mit ihr hielt. Und sie liebte die Alleen mit den Kastanien, den Jasmin und die Rosen in den Vorgärten hier in ihrem Viertel.
Dabei waren ihre Lebensumstände hier alles andere als ideal. Seit Ende der 80er Jahre erblindete sie als Folge einer unheilbaren Augenkrankheit, die letzten 6 Lebensjahre war es ihr ohne Hilfe nicht mehr möglich, die Wohnung zu verlassen. Mit großer Diszipliniertheit und dank ihres phänomenalen Gedächtnisses gelang es ihr, sich weiterhin allein in ihrer Wohnung – und vor allem ihrer Bibliothek – zurechtzufinden. Mit Hilfe eines Lesegerätes konnte sie Bücher, Zeitungen und ihre Manuskripte stark vergrößert lesen, ihre Texte schrieb sie – im 10-Finger-Blindschreiben geübt – auf einer elektrischen Schreibmaschine.
Ich lernte Johanna Moosdorf 1991 kennen, im Jahr ihres 80. Geburtstages. Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Madeleine Marti aus Zürich hatte sich – vermittelt über Prof. Dr. Ilse Kokula – an die damalige Bezirksbürgermeisterin, Monika Wissel, gewandt: Sie möge doch etwas für eine bekannte Schriftstellerin tun, die in Charlottenburg wohne, und zwar nach Möglichkeit noch zu deren Lebzeiten. Es entstand ein Frauenbündnis zur Überlistung von Johanna Moosdorf, die – wie ihr Sohn in einem Brief an den Bezirk besorgt feststellte -, jegliche Hilfe von außen ablehnte. Als Volkshochschulleiterin zum damaligen Zeitpunkt nahm ich Verbindung zu Johanna Moosdorf auf, engagierte eine Schauspielerin für eine Lesung anlässlich ihres Geburtstages, die in der Buchhandlung “Der Divan” in Anwesenheit von Johanna Moosdorf stattfand. Ich bot ihr außerdem meine Unterstützung an, sollte sie einmal Hilfe benötigen. Sie dankte mir dafür, meldete sich allerdings nicht. Sie lebte sehr zurückgezogen, war dennoch über alles sehr gut informiert, verfolgte das literarische, kulturelle und politische Leben über Zeitungen, Radio und Fernsehen. Kontakte nach außen waren eher die Ausnahme – eine davon ist Ingeborg Mues, Lektorin beim S. Fischer Verlag. Sie wird uns im Anschluss etwas aus ihrer Zusammenarbeit mit Johanna Moosdorf berichten.
Ein Jahr lang hörte ich nichts von Johanna Moosdorf, erst mein Geburtstagsgruß vom Jahr 1992 wurde beantwortet, und von diesem Zeitpunkt an ließ sie es zu, von mir als einer ganz fremden Person praktische Hilfe anzunehmen – zunächst Einkaufsdienste, später auch mehr und mehr Schreibarbeiten. Wenngleich ich Johanna Moosdorf das Funktionieren eines Laptops nicht erklären konnte, ließ sie sich darauf ein, mir regelmäßig ihrer maschinenschriftlichen Texte in diesen wundersamen Kasten zu diktieren, um dann bei meinem nächsten Besuch einen Ausdruck ihres jeweiligen neuen Manuskripts zu erhalten. Mit Hilfe des stark vergrößernden Lesegerätes konnte sie an dieser Textgrundlage dann weiterarbeiten, Korrekturen und Einschübe einfügen, die nächsten Seiten auf der Schreibmaschine schreiben usw. Das Frauenbündnis wurde übrigens bald erweitert um Brigitte Kippe, die Frauenbeauftragte des Bezirks, als die stark beanspruchte Schreibmaschine ihren Geist aufgab. Monika Wissels Reiseschreibmaschine “GABRIELE” hatte zwar einige Zeit lang aushelfen können, aber dann war erneut Ersatz angesagt. Es war schwierig, Mitte der 90er Jahre eine elektrische – nicht elektronische – Schreibmaschine aufzutreiben, die ohne ständige Reparaturen und vor allem ohne technische Finessen mit zusätzlichen Tasten funktionierte. Auf diesen versagte nämlich das 10-Finger-Blindschreibsystem von Johanna Moosdorf. Brigitte Kippe half uns als Expertin weiter: Sie ist bis heute leidenschaftliche Sammlerin von Schreibmaschinen und anderer Bürotechnik und konnte wie so oft auch hier einige Male bei der Beschaffung helfen.
Zwischen Johanna Moosdorf und mir wuchs über solche alltäglichen Gegebenheiten, vor allem aber durch die Schreibarbeit, eine respektvolle Vertrautheit – für mich ein Geschenk und ein einzigartiges Erlebnis, konnte ich doch so das allmähliche Entstehen einer Erzählung mitverfolgen, und zwar an erster Stelle! Meine Vorstellung von der mühelosen Inspiration der Künstlerin, gar eines Musenkusses, habe ich aufgrund dieser Erfahrung gründlich revidiert. Ich erlebte das Ringen um die Gestaltung, den Aufbau, die Konstruktion einer Geschichte und ihrer Personen, die wiederholt geänderte Form der literarischen Darstellung: Von der Ich-Erzählerin zur Beschreibung in der 3. Person, die Änderung von Namen, Neuzuschreibung von Berufen und vieles mehr.
Johanna Moosdorfs Briefe, Fotos u.a. Dokumente sind an das Literaturmuseum in Marbach gegangen, auch das zuletzt bearbeitete, unvollendete Manuskript mit dem Titel “Das verschwundene Haus”. Es besteht somit die Möglichkeit, über diesen Schaffensprozess weiter zu forschen und damit dem Werk einer Schriftstellerin gerecht zu werden, deren Romane nach 1945 mit zu den ersten in insgesamt fünf Sprachen (englisch, französisch, schwedisch, polnisch, serbokroatisch) übersetzten Arbeiten deutschsprachiger Nachkriegsliteratur gehören und die darüber hinaus mehrfache Literaturpreisträgerin ist.
Ihre Wahlheimat, das Land Berlin, hat es im letzten Herbst abgelehnt, ihre Grabstätte auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße als Ehrengrab anzuerkennen, “da u.a. das Andenken in der Öffentlichkeit nicht mehr fortlebt.” (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Brief vom 16.6.2005). Dieses Argument ist durch Tatsachen – heute und auch zukünftig – zu widerlegen. Da die Kinder von Johanna Moosdorf – inzwischen selbst um die 70 Jahre alt – sich um die Pflege der Grabstätte nicht auf Dauer werden kümmern können und in Deutschland keine Angehörigen leben, würde in absehbarer Zeit kein Ort der Erinnerung bleiben. Deshalb soll mit dieser Gedenktafel eine sichtbare Spur zum Werk von Johanna Moosdorf gelegt werden. Mit Hilfe zahlreicher Spenderinnen und Spender ist dies in kurzer Zeit möglich geworden; ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.