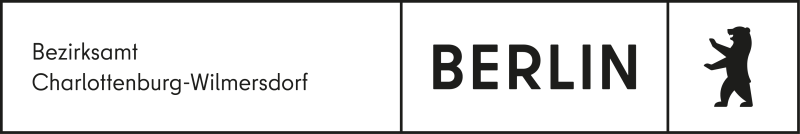Kooperationsveranstaltung der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin mit der Volkshochschule und Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf in der Johanna-Moosdorf-Bibliothek
“ … uns bringen sie vielleicht um, aber du
mußt weiterleben mit denen …”: Johanna Moosdorf
Frauenklage
Wo finde ich, hängend
im Strahlengitter fremder Träume
einen Boden für meine Füße
wie will ich, meiner Vergangenheiten
beraubt, Zukunft denken, wie
geduckt ins Zwielicht
feindlicher Gestirne
der Erde wieder vertraun
Ich beuge Nacken und Knie
unter das Gesetz der Widder,
lebe behütet oder ausgesetzt
in geborgter Haut
Kathedrale Katheder Schlachtfeld
Hirn und Tod
In kalter Weltnacht
irrlichtert mein Gebet
vor verbotenen Altären
meine Klage geistert
um der Toten weißes Gebein
Der 10. Todestag Johanna Moosdorfs ist ein trauriger, aber auch guter Anlass, uns die Lebensgeschichte und das Werk einer Autorin in Erinnerung zu rufen, die es in der Nachkriegsliteraturgeschichte und dem sowohl ostdeutschen wie westdeutschen Literaturbetrieb schwer gehabt hat. Über die Gründe, warum Johanna Moosdorf nicht so bekannt wurde, wie es angemessen gewesen wäre, mag man spekulieren. Bekanntlich bewirkte der Faschismus eine Diskontinuität in bezug auf die herrschenden Frauenbilder, einen Bruch in der literarischen Produktion von Frauen, einen Bruch in deren Wahrnehmung und Rezeption. Zudem ist Johanna Moosdorfs gesamtes Werk einem Thema gewidmet, das beim Aufbau der Nachkriegsgesellschaft verdrängt und bezeichnenderweise erst dann ´gesellschaftsfähig` wurde, als es in Form einer amerikanischen Seifenoper trivialisiert und in Form eines Fremdwortes beschwichtigt werden konnte: Die Rede ist vom Holocaust. Er sähe mit Schmerzen, daß sie “immer auf demselben
Thema” beharre, schrieb ihr Verleger Siegfried Unseld in den sechziger Jahren an die Autorin; gemeint war der Faschismus. Nicht, daß sich Johanna Moosdorf nicht auch für andere Themen interessiert hätte. Allerdings hat sie, ihrer “Vergangenheiten beraubt”, wie es in dem eingangs zitierten Gedicht heißt, dieser Vergangenheit und einem Toten in ihr, die Treue bewahrt.
Wie aber sich dieser Vergangenheit nähern, wie darüber reden oder schreiben? Eine Schmerzgrenze wird dabei immer wieder schnell erreicht. Ich habe sie oft als einen Widerstand in mir selbst, aber auch in Gesprächen oder im Briefwechsel mit Johanna Moosdorf empfunden: Was konnte und durfte ich fragen, was von dem mir Anvertrauten weitergeben?
Johanna Moosdorfs Leben wurde vom Holocaust schmerzlich heimgesucht und geprägt. Sie lebte auf Seiten der Opfer, schrieb auf Seiten der Opfer, war jedoch nicht selbst Opfer im strengen Sinne. Sie war keine Überlebende, sondern eine Weiterlebende, was ein doppeltes Ausgeschlossensein und eine doppelte Einsamkeit bedeutete. So wird in ihrem Roman Die Andermanns aus dem Jahr 1969 die junge (´arische`) Protagonistin von ihren angeheirateten jüdischen Verwandten bemitleidet: “Arme Kleine, uns bringen sie vielleicht um, aber du mußt weiterleben mit denen.”
Geboren wurde Johanna Moosdorf am 12. Juli 1911 in Leipzig, wo sie die Höhere Mädchenschule absolvierte. Ihr Vater war Buchdrucker, früh lernte sie die Literatur – auch literarische ´Prominenz` – jener Jahre kennen. Seit ihrer Kindheit stand es für sie fest, daß sie Schriftstellerin werden wollte; als Sechzehnjährige erbat sie zur Alternative Schreiben oder Malen brieflich einen Rat von Käthe Kollwitz – und Käthe Kollwitz riet zur Sprache. Nach dem Abitur ging Johanna Moosdorf nach Berlin, wo sie sich im Selbststudium mit Kunstgeschichte und Literatur beschäftigte. Zum Geldverdienen hielt sie Vorträge in Jugendgruppen: über Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Paula Becker-Modersohn, Maxim Gorki, Fjodor Dostojewskij, Rainer Maria Rilke. Sie heiratete früh, einundzwanzigjährig, da schrieb sie bereits Gedichte und Novellen. Im Mai 1933 sollte ein erster Gedichtband von ihr in einem kleinen, avantgardistischen Verlag erscheinen. Nach der Machtergreifung
durch die Nazis jedoch wagte der Dreisäulenverlag in Marburg die Veröffentlichung nicht mehr, da sie mit einem ´Juden` verheiratet und nicht Mitglied der Reichsschriftumskammer war.
Kennengelernt hatte sie ihren Mann, Paul Bernstein, Anfang der dreißiger Jahre. Bernstein, am 23. Juni 1897 geboren, also vierzehn Jahre älter als sie, war ein gewerkschaftlich und sozialdemokratisch orientierter Politologe, der freiberuflich als Dozent in der Jugend- und Erwachsenenbildung und als Publizist arbeitete. Als ihm eine Heimleiterstelle in einem von der Gewerkschaft betriebenen Heim für junge Arbeitslose angeboten wurde, heirateten die beiden, die eigentlich an die freie Liebe glaubten und den Stempel vom Standesamt für überflüssig hielten, um den formalen Anforderungen für diese Stelle zu genügen. Diese moderne Haltung gegenüber der Ehe – Bejahung eines idealistisch-romantischen Liebeskonzepts bei gleichzeitiger Indifferenz, ja Ablehnung gegenüber staatlich-bürokratischen Formalitäten – wird noch eine Rolle spielen.
Nur ein halbes Jahr, von November 1932 bis Mai 1933, leiteten Johanna Moosdorf und Paul Bernstein das Gewerkschaftsjugendheim in der Schlesischen Straße in Berlin-Kreuzberg; vom Dach dieses Hauses sahen sie den Reichstag brennen. Im Haus gegenüber befand sich übrigens eine Kaserne für durchreisende SA. Als am 1. Mai 1933 SA-Männer eine Hakenkreuzfahne auf dem Dach des Gewerkschaftsheims aufstellen wollen und eine Straßenschlacht zwischen den konträren Lagern droht, ging die junge Johanna, in einer bemerkenswerten Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit und Chuzpe, zur Polizei und zeigt die SA wegen Hausfriedensbruchs an -
mit Erfolg, die SA-Leute mussten wieder abziehen, samt ihrer Hakenkreuzfahne.
Nachdem im Mai 1933 das Heim geschlossen wurde, begann ein Leben in Unsicherheit: Berufsverbot für Paul Bernstein, illegale Arbeit, Gelegenheitsjobs. Für ihn als Politologen bot der Nationalsozialismus allerdings ein interessantes Studienobjekt, an eine persönliche Gefahr dachte er zunächst nicht und also auch nicht an Emigration. Hierzu äußerte sich Johanna Moosdorf mir gegenüber einmal im Gespräch:
“Ich habe schon beinahe ein Schuldgefühl wegen meiner blödsinnigen Sprachwurzeln. Mein Mann wollte ja auch nicht auswandern, aber vielleicht hätte er sich eher entschließen können zu gehen, wenn ich nicht noch so ein Hemmschuh gewesen wäre. Dann hätten wir (sic!) vielleicht irgendwo überlebt. Das habe ich mir oft gesagt. Ich höre meinen Mann noch reden: ,Was machst du dir für Gedanken! Die werden einen Krieg provozieren, das wird ein paar Jahre dauern und wird schrecklich werden, aber dann sind sie weg und wir können wieder zusammenleben. Du mußt nur die Jahre hier mit den Kindern überstehen.’ Ihn hat es politisch sehr interessiert, was hier los war. Auszuwandern, das empfand er im Grunde auch als feige. Wir haben gar nicht zur Kenntnis genommen, daß wir bedroht waren bis sonstwohin, und daß er eigentlich der Gefährdete war, ist uns gar nicht in den Kopf gekommen. Er hatte dauernd bloß Angst um mich, weil ich ein bißchen labil war und zart. Aber
nicht Angst um sich selber, das ist ja das Irre daran. Es war lächerlich, das alles, und das habe ich auch in einer Geschichte geschrieben. Wir waren ,lächerliche Menschen’.”
Die Geschichte, auf die sie hier anspielte, erschien 1986 unter dem Titel Verfinsterungen in den Neuen Deutschen Heften; später hat Johanna Moosdorf sie in ihren Roman Jahrhundertträume (1989) eingearbeitet. Darin erinnert und fragt sich die Protagonistin im Rückblick: “Konnte sie nicht verstehen, daß sich Karl, als es ums Letzte ging, als ,Mann’, als ,Oberhaupt bestätigen mußte? Das empfand sie beinahe als Verrat. Sollte denn vergessen sein, wie sie gemeinsam über den zum Herrenmenschen beförderten Spießbürger gespottet hatten, den Machtprotzen, der allerorten verkündet und gepriesen wurde? Ein prächtig herausstaffierter Gockel, feierte er seine billigen Triumphe auf der Straße, im Wirtshaus, in der Familie, bewundert und angespornt von seinem ergebenen, eifrig gackernden Weibervolk. … Es klingt paradox, aber es ist wahr: Jenny hat sich von ihrem Mann verlassen gefühlt, der auf einmal wie Hinz und Kunz ,bestimmte’, was zu tun war –
auch für sie. Es ist Angst gewesen, nichts als Angst, die ihn trieb, das wußte sie, Angst um die Seinen, aber noch heute verspürt sie ein heftiges Widerstreben gegen das Übermaß an Vernunft und ,Einsicht’, das ihr Leben beherrschen, dem sie sich unterwerfen sollte.”
Ein wenig weiter im Text ist die Rede von der “anderen Art” Angst, die die beiden quält: “Nicht um ihn, er war treu, war stark, ein gefestigter Mensch, nein, um sie, um Jenny bangten sie, unstet, wie sie war, labil, schnell und hitzig verliebt und wieder enttäuscht, verspielt, unpraktisch. Es war lächerlich, sag ich, sagst du, in der Tat, sehr lächerlich, sie waren lächerliche Menschen – er schwebt in höchster Lebensgefahr, und wir fürchten, einander fremd zu werden. Besonders Karl – verzeih! – war ein lächerlicher Mensch mit seiner Selbstlosigkeit mitten in der brutalsten Barbarei, seinen Anstandsbegriffen aus der bürgerlichen Mottenkiste.”
´Lächerlich` also die große Liebe und das kleine, private Glück, ´lächerlich` das Festhalten an überkommenen Geschlechtsrollen trotz besseren Wissens, ´lächerlich` die Freitagabendtreffen mit sozialdemokratischen Freunden, mit denen man gemeinsam literarische Studien betreibt; ´lächerlich` das Empfangen illegaler Zeitungen aus der Tschechoslowakei, die in Brötchen geschmuggelt wurden; ´lächerlich` schließlich der Kinderwunsch? 1935 und 1937 wurden die beiden Kinder, Barbara und Thomas, geboren. (Beide leben heute in den USA und sind uns heute auch in Gedanken verbunden.) 1938/39, nachdem Johanna und Paul beinahe alles, was sie besaßen, verpfändet und verkauft hatten, vor allem Möbel, aber auch Schmuck, Erbstücke von Paul Bernsteins Mutter, die 1934 gestorben war, suchte Johanna Moosdorf eine Arbeitsstelle, um die Familie ernähren zu können. Vergeblich, denn sobald sie angab, daß ihr Mann nicht ´arisch` war, wurde sie regelmäßig abgewiesen. Inzwischen
hatte Paul Bernstein, der als aufgeklärter Marxist uzovr nur lose Verbindungen zum Judentum gehabt hatte, Kontakte zur Jüdischen Gemeinde geknüpft. Mit der ihm eigenen Ironie spottete er, er sei nun “Mang die Juden jeschmissen” – Johanna Moosdorf hat diese Formulierung der Romanfigur Bruno Steiner in ihrem Roman Die Andermanns (1969) in den Mund gelegt.
“Mang die Juden jeschmissen” – mit Hilfe der Jüdischen Gemeinde begann Bernstein, ein Handwerk (Galvanisieren) zu erlernen, um im Ausland einem Broterwerb nachgehen zu können. Über Schweden wollte er in die USA auswandern, für die er durch Vermittlung einer Bekannten ein Affidavit erhalten hatte. Bernstein war es, der nun, im Frühjahr 1939, für eine Ehescheidung plädierte, damit seine Frau keinen weiteren Repressalien ausgesetzt sei, sondern unbehelligt für sich und die Kinder sorgen könnte, bis er die Familie nachholen oder aber bis “der Spuk vorbei” sei und er nach Deutschland zurückkehren könnte. Hierzu äußerte sich Johanna Moosdorf im Gespräch:
“Für uns persönlich war die Scheidung absolut bedeutungslos. Auch die Heirat bedeutete ja nichts, das war eine Formalität, ein Stempel vom Standesamt. Und die Scheidung war genau so eine Berechnung. Ich weiß nicht, ob es dumm war, jedenfalls war es die einzige Möglichkeit, die wir gesehen haben, denn wenn ich verheiratet geblieben wäre, hätte ich ja immer angeben müssen, daß mein Mann Jude war und hätte nichts verdienen können. Mir selbst wäre es piepegal gewesen, aber ich hatte ja nichts, und hatte die zwei Kinder. Im allgemeinen war es doch so, daß der ,arische’ Teil sich getrennt hat. Bei uns war es gerade umgekehrt. Bei uns ist alles verkehrt herum gewesen. Paul wollte – notgedrungen – geschieden werden, damit ich hier Ruhe hätte – die Kinder waren ja noch sehr klein, Tom gerade zwei Jahre. Nun, und dann ging der Krieg los, und da konnte er nicht mehr heraus, und wir saßen in der Falle. Unsere Beziehung war nun
,Rassenschande’.”
Es gehörte zur Perfidie des faschistischen Systems, den Opfern selbst die Schuld zu geben. Nicht nur kamen hier zwei Liebende der erzwungenen Trennung quasi noch zuvor. Um sich scheiden lassen zu können, mußte Bernstein darüber hinaus eine “Schuld” auf sich nehmen und einen Ehebruch fingieren. Der Zynismus nationalsozialistischer Rechtsprechung verlangte eheliche Untreue; da man vor dem Ausland noch als rechtsstaatlich, in Übereinstimmung mit internationalen Gepflogenheiten und dem Konkordat erscheinen wollte, sollte bei diesen Ehescheidungen jeder Eindruck eines Zusammenhangs mit den deutschen Rassegesetzen vermieden werden. Für Johanna Moosdorf und Paul Bernstein war das Ganze eine Farce, eine juristische Formalität. Um aber die Unauflöslichkeit ihrer eigenen Ehe vor einem Zeugen zu bekräftigen, vertrauten sie sich einem katholischen Theologen, dem Prälaten des Berliner Hedwig-Domes Bernhard Lichtenberg, an, der diese Notlüge vor dem Nazirichter
gewissermaßen absegnete und zu gegebenem Zeitpunkt auch die Annullierung der Ehescheidung “kraft seines Priesteramtes” bezeugen wollte.
Bernhard Lichtenberg (geboren 1875) – er hatte übrigens auch die beiden Kinder getauft, nachdem Johanna Moosdorf in den 30er Jahren zum Katholizismus konvertiert war – wurde 1941 wegen seiner öffentlichen Fürbitten für die verfolgten Juden und KZ-Häftlinge verhaftet; 1943 starb er auf dem Weg nach Dachau. In ihrem Roman Jahrhundertträume hat Johanna Moosdorf auch die schmerzlichen Geschehnisse um die erzwungene Ehescheidung verarbeitet und dem Dompropst ein kleines literarisches Denkmal gesetzt. Ich zitiere:
“Die Nazis zettelten ihren Krieg eher an als erwartet, Karls Pläne wurden illusorisch; er konnte das Land nicht mehr verlassen, Jenny und er saßen in der Falle. Mit einem Federstrich war aus ihrer Liebe Rassenschande geworden, ein todeswürdiges Verbrechen, und sie waren auch noch selber schuld daran, daß sie ihre Ehe nur noch heimlich, in dauernder Angst vor Entdeckung, fortsetzen konnten, eine Ehe, die von Anfang an im Zwielicht gestanden hatte; das wich nun einer Alptraumfinsternis.”
1943 wurde Paul Bernstein zum ersten Mal verhaftet, aber es gelang Johanna Moosdorf, mit Petitionen seine Freilassung zu bewirken. Das Argument, sie brauche ihren Mann als Ernährer für ihre beiden Kinder, überzeugte, weil es dem Rollenverständnis der Bürokraten entsprach. Wie Johanna Moosdorf erzählte, befand sich Paul Bernstein bereits im Zug, um deportiert zu werden, als über Lautsprecher die Aufforderung kam: “Paul Bernstein zurück!”
Dem Paar war noch ein knappes Jahr vergönnt, bis Paul Bernstein im Januar 1944 wieder verhaftet wurde. Er wurde zunächst nach Theresienstadt gebracht, wohin ihm Johanna Moosdorf Päckchen schicken konnte. Zur Antwort erhielt sie Postkarten mit dem Vordruck: “Mir geht es gut”, Unterschrift P. B. (Diese Karten sollten nach dem Krieg als Beweismittel für die Aufrechterhaltung der Ehe dienen.) Als den beiden ´halbjüdischen` Kindern ebenfalls die Deportation drohte, floh Johanna Moosdorf mit ihnen zu Verwandten ins sogenannte ´Sudetenland`; von dort aus schlug sie sich auch nach Theresienstadt durch, um nach ihrem Mann zu forschen, allerdings vergeblich. Im Herbst 1944 (September? Oktober?) wurde Paul Bernstein nach Auschwitz gebracht, seine genauen Todesumstände sind nicht bekannt. (Februar 1945?)
“Uns bringen sie vielleicht um, aber du mußt weiterleben mit denen”: Nach Kriegsende kehrte Johanna Moosdorf nach Leipzig zurück. Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch und mußte längere Zeit im Krankenhaus verbringen, ehe ihr ein Neuanfang als Schriftstellerin möglich war.
“ … ich staune noch heute”, denkt die Protagonistin, die uns schon bekannte ´arme kleine` Lucie, in Die Andermanns, “ … ich staune noch heute, wenn auch mehr über mich selbst, die ich noch immer existiere. Aufgestanden und weitergelebt, wie habe ich das nur gemacht.”
Einige Stationen des weiteren Lebensweges seien in Kürze resümiert: 1947 erschienen der Gedichtband Brennendes Leben und ein erster Roman, Das Bildnis, beide im Ost-Berliner Dietz-Verlag; 1948 wurde das Schauspiel Schneesturm in Worotschau mit großem Erfolg aufgeführt, übrigens von einer Laienspielschar, in der Uwe Johnson mitwirkte. (Die Novellenfassung, die 1957 bei Bertelsmann erschien, wurde 1991 in dem Sammelband mit Geschichten aus vier Jahrzehnten: Die Tochter wieder abgedruckt). Lesungen ihrer Gedichte waren zahlreich besucht, und Johanna Moosdorf wurde Kulturreferentin bei der Leipziger Volkszeitung und Chefredakteurin der literarischen Zeitschrift März. Jedoch geriet diese wegen “westlerischer und kosmopolitischer Tendenzen”, wie die Sprachregelung der Sowjetischen Militärbehörde lautete, zunehmend unter Druck und wurde nach Erscheinen der 4. Nummer im Jahr 1948 eingestellt. 1950 siedelte die Autorin – zusammen mit Gerhart Weidenmüller –
nach West-Berlin über, wo sie bis zu ihrem Tod gelebt hat. (Tafel an Wohnhaus Kastanienallee 27)
In den fünfziger Jahren erhielt sie Förderpreise von Carl Zuckmayer und Thomas Mann, 1963 wurde sie, als erste Preisträgerin nach Nelly Sachs selbst, mit dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet. Nachdem es in den sechziger und siebziger Jahren zunehmend still um sie geworden war, wurde ihr Werk Ende der achtziger Jahre neu entdeckt; Ingeborg Mues, verantwortlich für die Reihe Die Frau in der Gesellschaft, bot ihren Romanen, Gedichten und Erzählungen im Fischer Taschenbuch Verlag eine neue verlegerische Heimat.
Drei großen Themenkomplexen war Johanna Moosdorfs Werk gewidmet: Neben dem Bereich des Magisch-Dämonischen, der in einigen Gedichten, in ihrem Roman Die Nachtigallen schlagen im Schnee (1953) und im Hexenritt-Kapitel in Die Freundinnen (1977) eine Rolle spielte, waren dies vor allem die Auseinandersetzung mit dem Faschismus und dessen Kontinuität in der Bundesrepublik sowie die Gewinnung und Begründung einer weiblichen Perspektive. Beide Themenbereiche waren, wie Johanna Moosdorf sagte, “mehr oder weniger zwangsläufig aus biographischen Gründen” die ihren geworden; beide hat sie zunehmend auch inhaltlich miteinander verwoben. In dem 1947 veröffentlichten Gedicht Requiem ´In Memoriam Paul Bernstein` schwört das lyrische Ich dem Toten: “Zu leben und zu dienen deinem Werke”, und es beschwört andere Frauen, in die Totenklage einzustimmen:
Ich ruf euch alle, Mütter, Schwestern, Fraun,
An des Geliebten unbekanntem Grabe
Zu weinen und zu schreien, daß die Himmel
Erdröhnen von der Klage Sturmgewalt!
Im gesamten Schreiben Johanna Moosdorfs finden wir dieses Motiv: die Frau als Klageweib verkörpert sowohl das subjektive als auch das kollektive Gedächtnis. Während aber die frühen Gedichte noch von einem gewissen expressionistischen Pathos getragen sind, wird die Sprache zunehmend pointierter, wirkt nüchterner und sachlicher. Man kann sich diese Entwicklung veranschaulichen, indem man ein 1947 veröffentlichtes Gedicht mit dem Titel Frauenklage vergleicht mit dem 20 Jahre später entstandenen Gedicht, das ich eingangs zitierte. Im frühen Gedicht heißt es:
Wir sind die Schweigenden. Ach, eure Worte
Wie Vogelschwärme in der Einsamkeit,
Umschwirren lärmend die verschlossne Pforte
Zu unsres Daseins stiller Wesenheit.
Wir sind die Schweigenden. Wer will ermessen,
Was die verschuldet, die das Schweigen brach …
Während die hier gestellte Frage eher rhetorisch erscheint: “Wer will ermessen …”, wirken die Fragen im späteren Gedicht, wiewohl auch sie ins Unermeßliche zielen, konkreter und damit auch eindringlicher: “Wo finde ich Boden für meine Füße / wie will ich Zukunft denken, wie der Erde wieder vertraun …”
Das lyrische Ich hat sich aus der Gemeinschaft (auch Zwangsgemeinschaft) schweigender Frauen gelöst; seiner “Vergangenheiten beraubt”, betrauert das sprechende Individuum aber nicht nur die eigene historische Situation als Frau, sondern spricht im Namen aller Opfer, der Toten. Die stille Klage im frühen Gedicht – “ach, eure Worte …” – ist einer Anklage gewichen, und die drei Eckpfeiler patriarchalischer Herrschaft werden genau benannt: “Kathedrale Katheder Schlachtfeld”, also Religion, Wissenschaft und Kriegskunst. “Hirn und Tod” erscheinen in diesem Zusammenhang quasi als Synonyme.
Auch in ihren Romanen bringt Johanna Moosdorf Faschismus und männlichen Chauvinismus zunehmend in einen Zusammenhang: Nationalismus, Rassismus, Sexismus entstammen der gleichen Wurzel; sie richten sich gleichermaßen gegen den anderen, das andere, die andere. Am deutlichsten ausgearbeitet findet sich dieser Gedanke im Roman Die Freundinnen, in dem die gleichberechtigte Liebe zwischen zwei Frauen als Gegenpol zur männlichen Unfähigkeit zu lieben entworfen wird. Über die männliche Unfähigkeit, das oder die andere zu lieben und zu erkennen, heißt es da: “Die verstehen nur eins: Trennen. Auseinanderreißen. Töten, um zu erkennen. Es ist ja dann aber nur das Tote, das sie erkennen.”
Eine atemberaubende Passage über die “Männerwelt” als “Mörderwelt” findet sich in den bereits erwähnten “Andermanns” aus dem Jahr 1969. Aus der Perspektive der Großmutter, die wie eine Spinne im Netz ihrer Erinnerungen sitzt, werden die verschiedenen Motive: die Kritik männlich-patriarchaler Gewalt und das Bild der Frau als Hüterin der Erinnerung zusammengebracht:
“Würde, denkst du, in Würde altern, aber ich lache nur. Es möchte euch passen, nicht wahr, damit ihr nichts merkt, damit alles ungestört weitergeht. Es wird weitergehen wie seit Jahrtausenden, seit eh und jemals, seit aller Zeit. Generation um Generation, geboren, gelebt, gestorben, und jede hielt sich für neu, für besonders, für beauftragt und auserwählt oder für verdammt und betrogen, zog mit immer perfekteren Waffen in ihre heiligen Schlachten, hieb, stach, metzelte, knallte, donnerte, verbrannte, zertrümmerte, vergaste – Mörderwelt. Ihr Blutdunst raubt mir den Atem. Männerwelt, Welt von Männern gemacht – für Männer und beherrscht von Männern. Gott ist ein Mann. Ein Juristen- und Bürokratenhirn, logisch, gewalttätig, brutal und kalt, stolz auf das Netzwerk seiner Gesetze, in dem jeder sich fängt. … Ich, alt und fremd, eine fette Katze, im Winkel lauernd, eine Spinne, den Tod umgarnend. Erst, wenn sie alt werden, wenn das Kopfwackeln
anfängt, merken die Frauen, daß sie Fremdlinge sind, Gott weiß woher stammend, von welchem Stern. Die Jungen sind mit Blindheit geschlagen, sind Närrinnen, Verrückte, kratzen ihre Habe zusammen, beten, hoffen und gebären, auf daß es weitergehe, weiter auch in diesem Jahrhundert, weiter nach dem ersten Krieg und nach dem zweiten, immer weiter mit Millionen und aber Millionen Toten, verblutet, zerfetzt, verhungert, erschlagen, gehenkt, zerbombt – weiter, weiter, wer noch lebte, kroch aus den Löchern, den Bunkern, Gräben, Kellern und U-Bahn-Schächten, schüttelte das Entsetzen ab und lebte weiter mit seinem unstillbaren Hunger nach Fraß, nach Liebe, nach Bestätigung, nach Besitz, nach Macht. Vielleicht graut euch, wie mir graut …”
Aber auch wenn “Männer in Zivil und Uniform, in Braun, in Schwarz, immer mehr Männer in Uniform …” die Prototypen der Täter darstellen, so gibt es in allen Romanen Johanna Moosdorfs doch ebenso männliche Figuren, denen die eindeutige Sympathie, das Mit-Leiden, der Erzählerin gilt. Sie zählen zu den Opfern, so zum Beispiel in Die Andermanns der im KZ ermordete Jude Bruno Steiner, der schwarze GI und Deserteur Jerry und der farbige Junge Simon. Bei aller Männlichkeits- und Patriarchatskritik eignete Johanna Moosdorf eine zutiefst humanistische Weltsicht, die keine Schwarzweißmalerei duldete. In Jahrhundertträume formulierte sie ihr Credo, die Vision eines Menschenwesens, das “frei” wäre: “göttlich in seiner Doppelgestalt als Weib-Mann und Mann-Weib, nicht an Rollen gebunden, nicht in Grenzen eingeschlossen, die es nicht überschreiten durfte.”
Und nicht zuletzt zeichnete sie in der Figur des Karl Meerstern in diesem Roman ein anrührendes Porträt ihres Mannes Paul Bernstein und schuf damit zugleich eines der bewegendsten und schönsten Männerbilder in der neueren Literatur. Dazu hatte sie sich im Sommer 1986, drei Jahre vor Erscheinen von Jahrhundertträume, schon einmal in einem Gespräch mir gegenüber geäußert:
“Den Gedanken, einmal ein Porträt von Paul Bernstein zu schreiben, habe ich oft gehabt, und ich habe es auch schon ein paar Mal versucht, aber das Geschriebene nie veröffentlicht. Das war mir alles zu unzulänglich. Wenn er nicht auf so eine elende Art umgekommen wäre, wäre es leicht für mich. Aber wenn man sich derart unvollkommen vorkommt vor so einem Schicksal … Er hätte so gerne noch gelebt und Verschiedenes gemacht, er hatte den Kopf voll Pläne, sogar, als es ihm zuletzt, bei Siemens, so dreckig ging. Eine Beschreibung reichte einfach menschlich nicht heran. Ich habe immer zuletzt eine Hemmung gehabt. Ich käme mir vor, als ob ich irgend etwas verwerte, für meine Arbeit benütze, und das ist mir im Grunde zuwider. Es müsste ein anderer Antrieb dabei sein, der dieses Gefühl überholte, diese Angst, ihn zum Objekt zu machen. Das könnte man immer, solange dieser Tod nicht wäre – dann machte ich den anderen nicht zum Objekt, sondern schilderte ihn
eben. Aber es ist ja dieser Tod, wodurch die Menschen zum Objekt gemacht worden sind. – Ich kann mich bloß wundern, ich habe mich immer gewundert, die ganze Zeit, dass ich noch lebe.”
Soweit Johanna Moosdorf im August 1986; ein Jahr zuvor, im Sommer 1985, hatte ich sie zum ersten Mal zu einem Interview aufgesucht. Ein bisschen – das dürfen wir, glaube ich, schon sagen – haben auch wir Frauen, die wir die Schriftstellerin Johanna Moosdorf damals für uns – und für andere – entdeckten, zur Entstehung ihres Romans Jahrhundertträume beigetragen – indem wir Interesse an ihrer Lebensgeschichte zeigten, sie mit unseren Fragen herausforderten und ihr auch Mut machten. Ob sie mit Ende siebzig noch die Kraft für dieses große Projekt aufgebracht hätte, wenn sie nicht sicher gewesen wäre, dass Ingeborg Mues es verlegen würde?
Zum Abschluss möchte ich nun zwei Passagen aus Jahrhundertträume lesen und die Autorin somit selbst zu uns sprechen lassen. Für alle, die den Roman nicht kennen, vorab eine kurze Zusammenfassung.
Jenny Meininger, eine alternde Schriftstellerin – und es ist sicher kein Zufall, dass sie die Initialen J. M. mit der Verfasserin teilt – zieht in die Dachwohnung eines Berliner Gartenhauses, das sie an das Haus erinnert, in dem sie und ihr jüdischer Mann während des zweiten Weltkrieges Unterschlupf fanden. Es ist kein idealer, aber ein passender Ort, um die Geschichte ihres Mannes und ihre eigene Lebens- und Liebesgeschichte mit ihm aufzuschreiben. Um diesen Erzählstrang, also die Geschichte von Jenny Meininger und Karl Meerstern, in der Johanna Moosdorf Teile ihrer eigenen Lebensgeschichte verarbeitet hat, geht es vorrangig. Und auch in der Romangegenwart holt die Vergangenheit die Protagonistin ein. Zum einen, weil in dem Haus, in das sie zieht, lauter “Beschädigte” wohnen, seltsame Menschen, Außenseiter, die wie sie aus der Welt gefallen zu sein scheinen. Jonathan Weberknecht zum Beispiel, ein alter Nazi, so steht zu vermuten, ein Kriegsverbrecher
womöglich, auf jeden Fall ein Menschen- und Frauenfeind, der Frauenporträts anfertigt und diese dann seltsam verstümmelt. Oder Jutta Sommer, mit der Jonathan Weberknecht eine Affäre hat, die er aber im Grunde seiner Seele verachtet. Weberknecht ist der eine Hausbewohner, der in der Romangegenwart stirbt – er erschießt erst seinen kleinen Hund und begeht danach Selbstmord. Der andere Nachbar, der sterben muss, ist der alte Gewerkschaftsführer Johann Urbanke, ein KZ-Überlebender, der sich an Jenny noch aus seiner Jugendzeit erinnern will, da sie als Kinder in der selben Straße gelebt hätten. Scheinbar stirbt er eines natürlichen Todes, in Wahrheit aber erliegt er wohl einer Verletzung, die er sich zehn Jahr zuvor bei einer Demonstration zugezogen hatte, als ihn eine Frau mit der Spitze ihres Regenschirms in den Bauch stach. Jenny bemüht sich darum, Urbankes Freunde – KZ-Überlebende wie er – zu erreichen, da seine Familie, namentlich sein Sohn, diese
Freunde bei der Beerdigung nicht dabei haben will. Im Gespräch mit einem von ihnen bezeichnet sie Urbanke als “Jahrhundertträumer” – “Jahrhundertalpträumer”, wird sie korrigiert. Denn die Träume des 20. Jahrhunderts haben sich in Jahrhundertalpträume verwandelt, die Liebesgeschichte von Jenny und Karl endet mit der Deportation Karl Meersterns nach Auschwitz.
Aber zugleich, auch davon handelt der Roman, endet die Liebe eben nicht mit dem Tod, sondern besteht in der – literarischen – Erinnerung fort.
Lesung I “Verfinsterungen”; Jahrhundertträume, pp. 24-31
Neben der Liebe, die Jenny Meininger mit Karl Meerstern verbindet, handelt der Roman auch von Jennys Liebe zu zwei Frauen, der schwesterlich Gleichen, Thilde, mit der sie nach Karls Ermordung zusammenlebt, sowie der ´anderen`, Naomi, die eine entfernte Cousine von Karl ist und ebenfalls ein Opfer der Schoah wird.
In der Romangegenwart spielt außerdem Jennys ehemalige Mitschülerin Lieselotte Allwein eine Rolle; sie will Jenny angeblich immer schon geliebt haben, stellt ihr nach und versucht sie eines Abends auf Jennys Sofa zu verführen. Lieselotte Allwein ist es aber auch, die schließlich ein Wiedersehen zwischen Jenny und Thilde stiftet.
Der Epilog, aus dem ich abschließend lesen möchte, spielt Anfang der 80er Jahre, Jenny und Thilde, “weit über sechzig”, sind zu Besuch bei Lieselotte in deren “Eulenhaus” an der Ostsee. Am Ende ihres Romans lässt Johanna Moosdorf in der Freundschaft zwischen den Frauen, dem sinnlichen Genuss im Hier und Jetzt und in einer wie impressionistisch dahingetupften schönen Landschaft ein Stück Utopie aufblitzen. Und wenn Jenny, wie Sie gleich hören werden, “in einer weißglitzernden Gloriole aus Meerschaum und Sonnenglast verschwindet”, so ist in dieser Beschreibung auch ihr Mann Karl anwesend, dessen Nachname Meerstern, wie Sie wissen, für die Muttergottes steht: “Meerstern, ich dich grüße …”
Johanna Moosdorf liebte Marienbilder; eine alte Postkarte der Madonna im Rosenhag von Francesco Francia, die sie mir einst schickte, erinnert mich auf meinem Kaminsims an sie. Und natürlich können wir zu dieser “Gloriole aus Meerschaum und Sonnenglast” auch einen im Sonnenlicht funkelnden ´Bernstein` assoziieren, und so bleibt die erinnerte Liebe in der gegenwärtigen präsent und ist Teil der utopischen Begegnung, dieser Entgrenzung und Vereinigung.
Aber hören Sie selbst.
Lesung II, Epilog, “Jahrhundertträume” pp. 295-297 u. 299f.