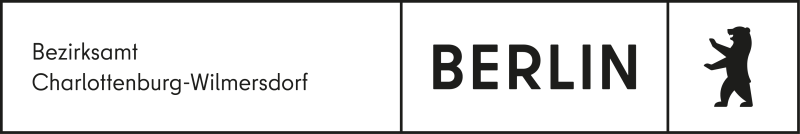Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schäfer!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Vielen Dank für die Einladung, an diesem ersten Fakultätstag der neuen Fakultät zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ihr Angebot, eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen einer wissenschaftlichen Einrichtung und der Stadt zu etablieren, ist ganz wunderbar, vor allem, wenn es auch Ihren Heimatbezirk betrifft. Es ist im Grunde etwas, wovon wir im Bezirksamt schon lange träumen, und ich bin sehr gespannt, wie dieser Traum sich nun in die Realität umsetzen wird.
Harald Bodenschatz hat den Traum von einer Stadt-Universität vorgestellt. Lassen Sie mich den Traum von einer dauerhaften Begegnung von Bezirk und Universität formulieren.
Wir haben in unserem Bezirk eine Reihe von wissenschaftlichen Institutionen von der Technischen Universität und der Hochschule der Künste bis zum Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und dem Wissenschaftskolleg. Alle diese Einrichtungen sind uns nicht gleichgültig, und wir suchen den Kontakt mit ihnen, wo immer es sich anbietet. Ehrlich gesagt haben wir dabei manchmal ein wenig den Eindruck, dass wir den Wissenschaftlern gleichgültig sind. Es ist nicht nur wie Theorie und Praxis, sondern auch wie zwei Welten, die da häufig aufeinanderstoßen und sich gegenseitig eher abstoßen.
Harald Bodenschatz hat sehr eindrucksvoll beschrieben, wie dieses gegenseitige Abstoßen sich sogar ganz konkret optisch im Stadtraum zwischen Charlottenburger Tor und Ernst-Reuter-Platz vermittelt. Er sieht in der Abwendung vieler Gebäude der Technischen Universität von ihrer Umgebung ein Indiz für eine Phobie der Universität vor der Stadt. Er entdeckt fast nur abweisende Erdgeschosszonen, versteckte Zugänge, Abstandsgrün und Distanzarchitektur.
Diese stadträumlichen Distanzen, Brüche und Abweisungen werden wir nicht so schnell aufheben können, obwohl es schon reizvoll ist, sich einen Universitätscampus mitten in der westlichen City Berlins vorzustellen, einladend für alle Passanten und Bewohner, animierend zum Austausch, zur Kommunikation und zum Besuch, eine Stadt des Wissens erfahrbar und auf Anhieb erkennbar machend.
Wie müsste das aussehen? Hätten die bestehenden Gebäude in einem solchen Bild noch Platz? Wie müssten sie aussehen? Könnte man vielleicht sogar schon mit einfachen Mitteln und wenig Geld etwas erreichen? Eine wahrhaft lohnende und faszinierende Forschungsaufgabe!
Die Berliner Bezirke mögen manchem Forscher suspekt sein, und das ist in gewisser Weise auch verständlich. Von der Bevölkerungszahl – meist über 300.000 – sind wir eigene Großstädte, aber unsere Bezirksverordnetenversammlungen haben weniger zu entscheiden als jeder Gemeinderat eines 1000-Seelen-Dorfes. Berlin ist zwar ein Bundesland, aber gleichzeitig auch eine Einheitsgemeinde, und die Bezirke sind keine selbständigen kommunalen Gebietskörperschaften, sondern lediglich Unterabteilungen der Einheitsgemeinde Berlin mit beschränkten eigenen Befugnissen, die ihnen im Zweifelsfall von der Hauptverwaltung auch wieder entzogen werden können. Dies geschieht regelmäßig, wenn die vom Bezirk vertretene lokale Perspektive zur übergeordneten Perspektive des Senats in Widerspruch gerät. Bei uns sind etwa die Bebauung des Teufelsbergs und der weitere Ausbau des Messegländes Beispiele, wo der Senat uns die Planungskompetenz entzogen hat.
Unsere Finanzen werden uns vom Senat zugeteilt. Inzwischen können wir zwar in einem Globalhaushalt eigene Schwerpunkte setzen, aber dies bleibt so lange Wunschdenken, wie uns die Finanzknappheit kaum Gestaltungsmöglichkeiten übrig lässt, weil die Globalsumme gerade mal für die gesetzlich festgelegten Aufgaben knapp ausreicht.
Die Struktur der zweistufigen Berliner Verwaltung wurde mit der Bildung Groß-Berlins 1920 im Prinzip festgelegt. Man hat damals nach fast 50jährigen heftigen Auseinandersetzungen einen Kompromiss zwischen Zentralisten und Dezentralen geschlossen. Nachdem sich vor allem die Großstädte im Westen Berlins, zu denen auch Charlottenburg und Wilmersdorf gehörten, vehement gegen die Eingemeindung gewehrt hatten, gewährte man den neuen Bezirken im Rahmen der neuen Einheitsgemeinde sehr beschränkte eigene Rechte.
Man schuf zwar die entsprechenden Institutionen, nämlich eine Bezirksverordnetenversammlung und ein Bezirksamt mit einem Bezirksbürgermeister und Bezirksstadträten, aber man stattete diese Institutionen nur marginal mit wirklichen Kompetenzen aus. An diesem sturkturellen Kompromiss krankt die Berliner Verwaltung bis heute. Eine neue, klarere Kompetenzverteilung zwischen Hauptverwaltung und Bezirken wäre dringend nötig. Sie ist auch mit der Gebietsreform nicht erreicht worden. Ich denke, dass eine mögliche Fusion der Bundesländer Berlin und Brandenburg auch für eine Reform der Berliner Bezirksstruktur neue Chancen eröffnet.
Könnte das nicht auch ein Thema für Sie sein? Könnten Sie nicht auch einmal untersuchen, wie Verwaltungsstrukturen sich auswirken auf Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung ihrer unmittelbaren Umwelt. Ich könnte mir von Ihnen gute, wissenschaftliche Argumente vorstellen für eine Stärkung der Bezirke, die im Sinne des Subsidaritätsprinzips alles entscheiden können sollten, was nicht unbedingt gesamtstädtisch entschieden werden muss. Die großen Senatsverwaltungen könnten in einer Stadt Berlin im fusionierten Bundesland Berlin-Brandenburg in kleine Magistratsabteilungen umgewandelt werden, die nur noch koordinierende und steuernde Aufgaben hätten.
Sie merken, ich habe ganz konkrete Hoffnungen, wenn ich Ihr Angebot zur verstärkten Zusammenarbeit mit Inhalt fülle. Denn um diese Inhalte geht es ja vor allem, wenn Universität und Kommune mit neuer Intensität kommunizieren wollen. Ich freue mich sehr darauf, dass diese Welten sich nun vielleicht häufiger begegenen, sich gegenseitig kennen- und vielleicht sogar schätzen lernen, dass Sie vielleicht die kommunale Praxis in Berlin unter ihre analytische Lupe nehmen und wir von Ihnen theoriegeleitete Impulse für unsere kommunalen Aufgaben erhalten.
Das betrifft auch ganz praktische Fragen wie das gegenseitige Kontakthalten, die gegenseitigen Einladungen zu Veranstaltungen, aber auch hier vor Ort bei der räumlichen Nähe das gegenseitige Aushelfen etwa mit Räumlichkeiten, wie wir dies schon in Vergangenheit beispielsweise mit der Friedensburg-Oberschule tun konnten.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir gemeinsam Wettbewerbe zu kommunalen Themen kreieren oder dass Sie städtebauliche Projekte und Wettbewerbe wissenschaftlich begleiten und unterstützen.
Sie haben den Prozess der Lokalen Agenda im Bezirk angesprochen. Auch hier sind Impulse aus der Wissenschaft hoch willkommen. Sie könnten uns vermutlich helfen, unsere Maßnahmen in diesem Kontext stärker als bisher mit den Maßnahmen anderer Kommunen zu vernetzen und abzustimmen, auch von anderen mehr noch als bisher zu lernen. Und wir können Ihnen sicher einen Begriff davon vermitteln, wo genau das theoretisch Wünschbare und im Grunde auch Notwendige an das Machbare und im demokratischen Prozess auf der kommunalen Ebene Vermittelbare stößt. Wir machen bei solchen Zusammenstößen immer wieder die Erfahrung, dass es nicht einfach ist, Verständnis füreinander aufzubringen. Wenn der Praktiker den Theoretiker für weltfremd und abgehoben und der Theoretiker den Praktiker für borniert und phlegmatisch hält, dann sind gegenseitige Lernprozesse schnell blockiert.
Sie haben mich gefragt, welche Erwartungen ich an die neue Fakultät habe. Lassen Sie mich meine kommunalpolitischen Träume so zusammenfassen:
Es wäre wunderbar, wenn Sie uns eine Reform der Organisationsstruktur der Kommunalverwaltung in Berlin vordenken, die im Zuge der Länderfusion von Berlin und Brandenburg realisiert werden könnte.
Es wäre wunderbar, wenn Sie unseren Horizont durch wissenschaftliche Analysen erweitern und uns beispielsweise helfen herauszufinden, was unsere Bürgerinnen und Bürger von der Kommunalverwaltung erwarten, was sie brauchen, worauf sie angewiesen sind.
Es wäre wunderbar, wenn Sie sich zu uns in die kommunale Praxis der Berliner Bezirke begeben, unsere Arbeit wahrnehmen und diese Praxis in die wissenschaftliche Diskussion einbringen könnten.
Es wäre wunderbar, wenn Sie uns mit Ihren wissenschaftlichen Fragen auf neue Ideen bringen könnten, wie wir die Umwelt und Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner und für die Gäste unsers Bezirks bewahren und verbessern können.
Es wäre wunderbar, wenn Sie uns wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Frage geben könnten, wie wir die immer knapper werdenden öffentlichen Finanzmittel so einsetzen können, dass die Verhältnisse in unserem Bezirk nicht schlechter sondern vielleicht sogar besser werden. Das betrifft die öffentlichen Plätze mit ihren sprudelnden Brunnen genauso wie die kulturellen Einrichtungen zur Breitenbildung und den Verwaltungsservice für die Bürgerinnen und Bürger. Das betrifft aber auch die Modernisierung der Kommunalverwaltung im Internetzeitalter. Wir spielen im Internet eine Vorreiterrolle unter den Berliner Bezirken und sehen eine große Chance darin, Verwaltungsabläufe transparenter und bürgerfreundlicher zu gestalten.
Damit bin ich keineswegs am Ende der Wünsche angelangt. Aber ich möchte jetzt doch zum Ende kommen. Auch wenn die vielen Wunder, von denen ich gesprochen habe, sich nicht alle verwirklichen lassen – es wäre schon viel gewonnen, wenn wir in Kontakt blieben und gegenseitig voneinander lernen könnten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Ihrer neuen Fakultät alles Gute und viel Erfolg.