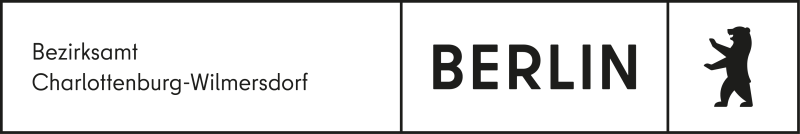am 29.4.2002, 9.00 Uhr im Wald-Gymnasium, Waldschulallee 95, 14055 Berlin
Sehr geehrter Herr Ismer!
Sehr geehrte Gäste und Partner des Waldgymnasiums!
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Damen und Herrn!
Vielen Dank für Ihre Einladung zu dieser Eröffnung Ihrer Europawoche unter dem Thema “Berlin – eine europäische Metropole”. Ich freue mich ganz besonders, die Gäste aus Genf, Warschau, Vilnius und Leksand begrüßen zu dürfen. Sie sind hierher gekommen, um gemeinsam mit Ihren Berliner Partnern über Berlin nachzudenken. Ich hoffe, dass Sie dabei aus Ihren eigenen Heimatstädten berichten werden und uns Berlinern damit die Augen öffnen für vieles, was wir nicht sehen können, wenn wir nur im eigenen Saft schmoren und uns mit uns selber beschäftigen.
Herr Ismer hat mich gebeten, Ihnen meine Sicht des Themas vorzutragen. Ich will dies gerne tun und einige Aspekte ansprechen, die mir wichtig erscheinen, ohne die Diskussion in Ihren Arbeitsgruppen vorwegzunehmen. Das Thema ist im Grunde unerschöpflich. Deshalb möchte ich mich auf einige Aspekte beschränken. Ich will sie unter folgende fünf Überschriften stellen:
Metropole und Provinz
Geschichte und Zukunft
Ost und West
Vielfalt und Verständigung
Welt und Heimat
Metropole und Provinz
Lassen Sie mich damit beginnen, Ihr Thema in Frage zu stellen: Ist Berlin überhaupt eine europäische Metropole? Oder anders gefragt: Was macht eine Metropole aus? Ist es die Einwohnerzahl? Oder die Geschichte? Die politische Hauptstadtfunktion, die Zahl der Opernhäuser, Kinos und Theater, das Nachtleben, das Tempo der öffentlichen Verkehrsmittel, ein internationaler Flughafen oder die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus aller Welt?
Erich Kästner hat den Gegensatz von Metropolenbewohnern und Touristen aus der Provinz in einem bösen Gedicht beschrieben. Es trägt den Titel:
Besuch vom Lande
Sie stehen verstört am Potsdamer Platz.
Und finden Berlin zu laut.
Die Nacht glüht auf in Kilowatts.
Ein Fräulein sagt heiser: “Komm mit, mein Schatz!”
Und zeigt entsetzlich viel Haut.
Sie wissen vor Staunen nicht aus und nicht ein.
Sie stehen und wundern sich bloß.
Die Bahnen rasseln. Die Autos schrein.
Sie möchten am liebsten zu Hause sein.
Und finden Berlin zu groß.
Es klingt, als ob die Großstadt stöhnt,
weil irgendwer sie schilt.
Die Häuser funkeln. Die U-Bahn dröhnt.
Sie sind das alles so gar nicht gewöhnt.
Und finden Berlin zu wild.
Sie machen vor Angst die Beine krumm.
Und machen alles verkehrt.
Sie lächeln bestürzt. Und sie warten dumm.
Und stehn auf dem Potsdamer Platz herum,
bis man sie überfährt.
Auch uns Berlinerinnen und Berlinern wird heute gerne vorgehalten, wir seien gar keine richtigen Metropolenbewohner, sondern ziemlich provinziell. Wir interessieren uns nur für unseren Kiez, vielleicht noch für unsere Laube in der Kleingartenkolonie und fühlen uns ansonsten gestört, wenn einmal wieder ein Staatsbesuch für Staus auf den Straßen sorgt, wenn aus der Nachbarwohnung laute türkische Musik schallt oder wenn die Besucherinnen und Besucher der Love-Parade ihren Müll im Tiergarten hinterlassen.
Als Bezirksbürgermeisterin weiß ich, wovon ich rede. Denn im Bezirksamt haben wir ständig damit zu tun, für einen Ausgleich zu sorgen zwischen den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger und den Zumutungen, mit denen sie in der Großstadt konfrontiert werden: Der Spielplatz ist verdreckt, die Hauswände sind mit Graffitis verschmiert, die Jazzkneipe zu laut, und zu wenig Parkplätze gibt es sowieso. Wir müssen und wollen die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger nach Lebensqualität ernst nehmen. Sie haben wie wir alle ein Recht auf gute Lebensbedingungen.
Aber natürlich meint der Vorwurf, provinziell zu sein, mehr. Provinziell ist, wer nicht weltoffen ist, wer engstirnig nur seine eigenen Maßstäbe gelten lässt, wer alles ablehnt, was ihm fremd ist, wer mit moderner Kunst nichts anfangen kann, neue Musik als Lärm empfindet und keine Lust hat, fremde Sprachen zu lernen.
Aber hat dieser Vorwurf überhaupt etwas zu tun mit dem Gegensatz von Stadt und Land, von Dorf und Metropole? Oder ist es nicht vielmehr ein Gegensatz, der sich durch das ganze Land zieht? Finden wir nicht überall aufgeschlossene und verschlossene Menschen, tolerante und intolerante?
Ich denke, wir sollten sehr misstrauisch sein gegenüber dem Vorwurf des Provinziellen. Er fällt nicht selten auf den zurück, der ihn erhebt. Für eine Definition des Metropolenmenschen taugt er im Grunde nicht, denn selbstverständlich lebt die Metropole vom Zustrom aus der Provinz, und für Überheblichkeit gegenüber Dorfbewohnern besteht kein Anlass. Wenn etwas provinziell ist, dann ist es Arroganz und Überheblichkeit.
Mich würde es sehr interessieren, von Ihren Gästen aus Genf, Warschau, Vilnius und Leksand zu erfahren, ob dieser Gegensatz zwischen Provinz und Metropole bei ihnen eine ähnliche Rolle spielt wie bei uns, ob man dort auch gerne den anderen als provinziell beschimpft, um sich als weltmännisch zu geben.
Wir sind also durch den Verweis auf die Provinz nicht recht weitergekommen mit einer Antwort auf die Frage: Was ist eine Metropole? Ich möchte es deshalb in einem zweiten Anlauf versuchen mit dem Begriffspaar
Geschichte und Zukunft
Wir wollen nicht zu den Ewiggestrigen gehören, aber auch die Gegenwart bietet uns keine Zukunftsperspektive, wenn wir unsere Geschichte nicht kennen. Berlin ist im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten eine junge Stadt. Wir haben zwar vor einigen Jahren 1987 die 750-Jahr-Feier Berlins veranstaltet, aber eine wirkliche europäische Bedeutung hat Berlin seit nicht viel mehr als 150 Jahren. Mit der langen Tradition von Paris, London, Prag, Budapest oder gar Rom und Athen können wir nicht mithalten. Die historischen Glanzlichter in unserer Stadt wie zum Beispiel das Brandenburger Tor sind um die 200 Jahre alt oder auch nur gut 100 Jahre wie der Reichstag, und die meisten sind nicht mehr im Originalzustand erhalten, sondern aus Trümmern rekonstruiert wie die Staatsoper oder das Schloss Charlottenburg.
Die kurze Geschichte Berlins als Metropole ist charakterisiert durch eine unglaublich rasante Entwicklung und durch katastrophale Zerstörungen – nicht durch Naturgewalten wie in Pompeji oder San Fransisco, sondern durch staatlich gelenkten Terror und Krieg. Diese Zerstörungen betreffen das Äußere der Stadt, ihre Gebäude und Anlagen, sie betreffen aber noch viel mehr ihre Substanz, die Menschen und ihre Leistungen.
Ihre unangefochtene Blütezeit als Metropole hat Berlin in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebt. Damals musste jeder nach Berlin kommen, der die aktuellen Trends erleben wollte, der kulturell oder wissenschaftlich auf der Höhe seiner Zeit sein wollte. Damals war Berlin international: Amerikanische Filme liefen in den Kinos am Kurfürstendamm in der Originalsprache, man traf sich in den Tanzlokalen zum Five o’clock Tea und verständigte sich per Tischtelefon.
In unserem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf erinnern fast 300 Gedenktafeln an bedeutende Persönlichkeiten. Die meisten von ihnen haben im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gelebt, und viele von ihnen wurden von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben oder ermordet: Vicki Baum, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bert Brecht, Lion Feuchtwanger, George Grosz, die Familie Kempinski, Heinrich Mann, Hans Ullstein, um nur ganz wenige zu nennen. Viele von ihnen waren Juden, und nicht zuletzt ihr Beitrag zur deutschen Wissenschaft und Kultur hat Berlin die Bedeutung verliehen, die es damals hatte. Man denke nur an Albert Einstein, Max Liebermann, Ernst Lubitsch oder die Comedien Harmonists.
Das Jüdische Museum ist heute eine der Hauptattraktionen Berlins, und es erinnert uns schmerzhaft daran, dass wir bis heute nicht überwunden haben, was die Nationalsozialisten zerstört haben. Ihr Rassenwahn, ihr barbarischer Hass richtete sich ja nicht einmal gegen Fremde, sondern gegen einen großen Teil des eigenen Volkes. Von fast 200.000 Berliner Juden in den 20er Jahren überlebten etwa 4.000.
Was bedeutet diese Phase unserer Geschichte, die kaum 60 Jahre zurückliegt, für unsere Gegenwart?
Bei der Diskussion um den Bau des großen Mahnmals für die ermordeten Juden Europas wurde oft die Befürchtung laut, wir Deutsche könnten eine Art Sündenstolz entwickeln. Das heißt, die notwenige Aufarbeitung unserer Geschichte könnte umschlagen in ein moralisches Überlegenheitsgefühl: Weil unsere Vorfahren so böse waren, sind wir besonders gut. Wir haben keinen Grund zur Überheblichkeit, aber wir sollten uns zu unserer historischen Verantwortung bekennen und uns aktiv und gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn mit unserer Geschichte auseinandersetzen, um daraus für die Zukunft zu lernen.
Gerade in den letzten Jahren ist uns manche Gewissheit abhanden gekommen. Für viele war der Satz “Nie wieder Krieg!” eine logische Konsequenz aus der von Deutschland ausgelösten Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Aber als die kriegerischen Auseinandersetzungen in Jugoslawien immer mehr die Dimensionen eines Völkermordes anzunehmen drohten, da stellte sich plötzlich die Frage, ob nicht militärische Einsätze nötig sind. Begründet wurde der Einsatz deutscher Soldaten auch mit dem Satz “Nie wieder Auschwitz!”
Wir haben allen Grund, schnellen Antworten auf historische Fragen zu misstrauen. Historische Nabelschau und ein Leben in der Vergangenheit bringt uns nicht weiter, aber wenn wir die Verständigung mit unseren Nachbarn suchen, gerade mit unseren osteuropäischen Nachbarn, dann geht das nur, wenn wir unsere Geschichte nicht verdrängen, sondern offen darüber sprechen, uns notfalls auch offen darüber streiten, welche Konsequenzen aus Krieg, tausendfachem Mord, Flucht und Vertreibung zu ziehen sind. Eine friedliche Zukunft Europas können wir nur sichern, wenn wir die noch immer schmerzhaften Wunden nicht ignorieren und wenn wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit die richtigen Schlüsse ziehen. In diesem Prozess der Verständigung spielt Berlin eine besondere Rolle. Von hier aus nahm der nationalsozialistische Terror seinen Anfang und überzog ganz Europa mit einer furchtbaren Zerstörungskraft. Hierher kam er aber auch mit schrecklicher Gewalt zurück. Bis heute sind die Spuren überall in der Stadt sichtbar und spürbar.
Berlins Zukunft als Metropole liegt im zusammenwachsenden Europa – ganz sicher nicht in der größenwahnsinnigen Vorstellung der Nationalsozialisten von einer alles beherrschenden und dominierenden Hauptstadt Germania – eher in einem Kommunikationszentrum an der Nahtstelle der lange getrennten Ost- und Westhälfte Europas. Der neu entstehende Lehrter Bahnhof als Kreuzungsbahnhof in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung könnte dafür ein Symbol werden. “Transit Berlin” heißt ein schönes Buch über die 20er Jahre. Vielleicht werden in Zukunft die Umsteigemöglichkeiten, die Berlin bietet, zum Markenzeichen für unsere Stadt.
Ost und West
Mein drittes Kapitel hat damit zu tun: Die geografischen Begriffe Ost und West wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zu politischen Begriffen, und auch 12 Jahre nach der Wiedervereinigung unserer Stadt haben wir die Folgen der Teilung nicht überwunden. Viele Besucherinnen und Besucher Berlins beklagen sich, dass kaum noch etwas sichtbar ist von der Mauer, die Ost- und West-Berlin fast 30 Jahre lang brutal getrennt hat. Vielleicht war es ja auch ein Stück Verdrängung und Sehnsucht nach Normalität, die uns bewogen haben, so schnell die meisten Spuren der Teilung Berlins zu beseitigen, so dass wir heute danach suchen müssen und fast schon ungläubig in alte Stadtpläne schauen. Vielleicht hätte ein begehbarer Mauerstreifen ein eindrucksvolles Symbol werden können für die unsinnige gewaltsame Trennung von Menschen, vor allem aber dafür, dass eine solche Trennung vor der Geschichte keinen Bestand haben kann.
Das Ende der Trennung war ein großes Glück für uns Deutsche und vor allem für Berlin. Natürlich haben wir in Charlottenburg-Wilmersdorf nach dem Fall der Mauer akzeptieren müssen, dass Kurfürstendamm und Breitscheidplatz nicht mehr die Mitte Berlins sind. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf den Potsdamer Platz, die Friedrichstraße, Alexanderplatz, Unter den Linden und Hackescher Markt. Die Galerie der Romantik musste aus dem Schloss Charlottenburg auf die Museumsinsel umziehen, und wir mussten aufpassen, dass die Attraktivität der City-West nicht verloren ging. Aber inzwischen ist klar: Ganz Berlin profitiert von der Konkurrenz der Zentren. Und diese Konkurrenz verschiedener Zentren ist für Berlin nicht neu. Sie entstand mit der Entwicklung des Kurfürstendammes zum Boulevard vor 100 Jahren und wurde bereits damals zum Markenzeichen Berlins. Diese Konkurrenz wurde lediglich unterbrochen durch die Trennung der politischen Systeme in Ost und West. Nach wie vor aber ist die City-West rund um die Gedächtniskirche die meist besuchte Einkaufsmeile Berlins, und nachdem sie immer wieder totgesagt wurde, erleben wir sie jetzt in einem neuen Aufschwung.
Ich denke, Berlin hat eine große Chance, das Zusammenwachsen der beiden Stadthälften kreativ zu gestalten und die unterschiedlichen historischen Erfahrungen für die Vielfalt der Stadt fruchtbar zu machen. Es kommt nicht darauf an, Ost- und Westerfahrungen einander anzunähern, sondern die unterschiedlichen Biographien anzuerkennen und sie fruchtbar zu machen für die zukünftige Entwicklung.
Wir pflegen auch in unserem Fusionsbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ganz bewusst die Identität der einzelnen Kieze, denn gerade diese historisch gewachsene Vielfalt ist es, die den Reiz der Stadt für ihre Bewohner und für die Besucher ausmacht.
Vielfalt und Verständigung
Es ist wohl unbestreitbar, dass gerade die Vielfalt der unterschiedlichsten Kulturen und Lebensstile auf engstem Raum das wesentliche Merkmal einer Metropole ist. Oft existieren diese verschiedenen Kulturen unverbunden nebeneinander. Interessant wird es dann, wenn eine Verständigung möglich wird, wenn aus dem Nebeneinander der Gegensätze etwas Neues entsteht. Toleranz reicht dafür nicht aus. Deshalb habe ich über meinen vierten Gedanken das Begriffspaar Vielfalt und Verständigung gestellt. Toleranz ist zwar die Grundvoraussetzung für das Zusammenleben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Aber wenn daraus mehr entstehen soll als gegenseitige Duldung, dann braucht es Neugierde, Gastfreundschaft, die Bereitschaft dem anderen zuzuhören und Perspektiven für gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Wir feiern in Wilmersdorf seit 15 Jahren das Fest der Nationen, um ein wenig dazu beizutragen, dass aus einem Nebeneinander ein Miteinander wird. In der Musik erleben wir es immer wieder als besonders beglückend, wenn aus der Begegnung verschiedener Kulturen etwas Neues entsteht. World-Music ist seit einigen Jahren ein Trend, der in London, Brüssel und Paris besonders fruchtbar ist. Auch in Berlin gibt es Ansätze, aber noch immer leben die Kulturen in unserer Stadt weitgehend unverbunden nebeneinander her. In Europa hat die Vielfalt der Sprachen immer die unkomplizierte Verständigung erschwert, aber die Sprachenvielfalt ist auch eine ungeheure Bereicherung und eine große Chance, denn in den Sprachen ist die kulturelle Vielfalt aufbewahrt. Sprachen lernen heißt seinen Horizont erweitern, sich eine neue Welt erschließen.
Wir haben in Charlottenburg-Wilmersdorf Europaschulen mit den Sprachenschwerpunkten polnisch, englisch, französisch und spanisch, und viele Schulen haben inzwischen lebendige Partnerschaften mit Schulen in anderen Ländern entwickelt. Das Wald-Gymnasium ist dafür ein besonders vorbildliches Beispiel, und Projekttage wie diese Europawoche sind genau das, was wir brauchen.
Welt und Heimat
Damit komme ich zum letzten Kapitel und zum Schluss meiner Überlegungen zu Ihrem Thema. Globalisierung heißt das Stichwort der gesellschaftspolitischen Diskussionen der letzten Jahre. Ein wenig enthält dieser Begriff den Überschwang einer Hoffnung auf das Ende der Geschichte nach der Beendigung des Kalten Krieges. Mit dem Untergang der meisten staatssozialistischen Systeme und dem Anschluss der osteuropäischen Länder an das westliche Wirtschaftsmodell schien die Einheit einer globalen Weltgemeinschaft in greifbare Nähe gerückt. Technische Entwicklungen wie das Internet verstärkten diesen Eindruck, geben sie uns doch die Illusion, die ganze Welt auf einem kleinen Bildschirm zur Verfügung zu haben.
Diese Illusionen sind verschwunden. Neue weltweite Konflikte und Konfrontationen sind entstanden, es gibt weltweiten Widerstand gegen die Global Player, und viele Menschen suchen wieder verstärkt nach heimatlichen Bindungen.
In Berlin können wir das genau so gut beobachten wie anderswo. Kiezbewusstsein und Weltstadt liegen untrennbar eng nebeneinander. Die Menschen wehren sich gegen Veränderungen in ihrer unmittelbaren Umgebung – ob es die Kleingärtner sind, die ihre Lauben nicht aufgeben wollen, oder die Bewohner eines Stadtviertels, die eine Bürgerinitiative gegen ein Bauprojekt gründen – die meisten wollen die Gewissheiten ihres Alltags nicht aufgeben, ihre Heimat nicht verlieren.
Wir dürfen diese Bedürfnisse nicht ignorieren. Gerade in der Kommunalpolitik geht es darum, einen Ausgleich zu finden zwischen den neuen Erfordernissen einer sich rasant verändernden Welt und dem menschlichen Bedürfnis nach Heimat. Heimatgefühle und Weltoffenheit schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Nur wer sich für seine eigene Welt interessiert, kann auch Interesse aufbringen für andere Welten. Wer seine eigene Heimat mag, der wird auch verstehen, dass seine Gäste ihre eigene Heimat mögen und er wird ihnen gastfreundlich und voller Interesse für ihre Erzählungen begegnen.
Joachim Ringelnatz hat seine Heimatgefühle in einem schönen Berlin-Gedicht formuliert. Es trägt den Titel
Sehnsucht nach Berlin
Berlin wird immer mehr Berlin.
Humorgemüt ins Große.
Das wär’ mein Wunsch: Es anzuziehn
Wie eine schöne Hose.
Und wär’ Berlin dann stets um mich
Auf meinen Wanderwegen.
Berlin, ich sehne mich in dich.
Ach komm mir doch entgegen!
Ich heiße die Gäste aus Genf, Warschau, Vilnius und Leksand noch einmal herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen gemeinsam mit Ihren Berliner Gastgebern eine gute, erlebnis- und erkenntnisreiche Europawoche im Wald-Gymnasium.