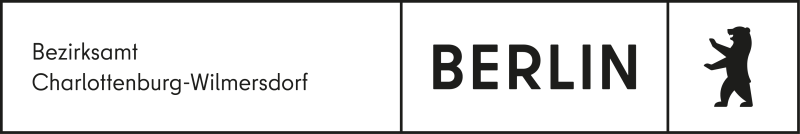Liebe Gemeinde,
liebe Schwestern und Brüder,
ich habe mich über die Einladung, heute mit Ihnen den Auftakt des Themenjahres „Reformation und Kirche“ der Evangelischen Kirche in diesem FOCUS-Gottesdienst gestalten zu dürfen, sehr gefreut. Ich lade Sie meinerseits nun herzlich ein, sich gemeinsam mit mir auf einige Gedanken zum Thema „Stadt zwischen Himmel und Erde“ einzulassen.
„Stadtluft macht frei!“ Dieser schöne Satz stammt aus dem Mittelalter. Genau genommen ist es ein Rechtsgrundsatz. Vollständig lautet er: „Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag.“ Er besagt, dass ein Leibeigener, wenn er in eine Stadt gelangte und dort ein Jahr und einen Tag lebte, nicht mehr von seinem Dienstherrn zurückgefordert werden konnte. Er wurde so zum freien Bürger. Heute erleben vor allem junge Menschen den Umzug vom Land in die Stadt oft als eine Befreiung von einengenden Regeln, Gewohnheiten und Gebräuchen.
Man könnte die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Verstädterung schreiben: Vom Nomadendasein über die ländliche Ansiedlung hin zur Stadt. Die Entwicklung der Städte ist ein Ergebnis der immer weiter fortschreitenden Arbeitsteilung. Erst wenn auf dem Land Lebensmittel im Überfluss produziert werden, können die Menschen in den Städten versorgt werden und sich auf Dinge konzentrieren, die nichts mit der Lebensmittelproduktion zu tun haben: Auf Handel, Kultur, Wissenschaft, Finanzwesen, Politik und Jurisprudenz. Die Grundlagen unserer Kultur entstanden in Städten, in Jerusalem, Alexandria, Konstantinopel, Athen, Rom, Venedig…
Unsere Zivilisation wäre ohne die freie Stadtluft so nie entstanden. Der Reiz der Städte für ihre Bewohnerinnen und Bewohner bestand und besteht bis heute darin, dass sie ihre unterschiedlichen Lebensstile leben können. Auch für die Kirchen bedeuteten die Städte eine Bereicherung. Sie haben sich in den Städten entwickelt und entfaltet. Die großen Kathedralen, religiöse Kunst, Musik und die Theologie entstanden vor allem in den Städten. Heute bedeuten die Städte für die Kirchen, ja für alle Religionsgemeinschaften eine Herausforderung. Denn die Geschichte der Urbanisierung ist zugleich eine Geschichte der Säkularisierung. Moderne Stadtgesellschaften sind geprägt durch das Aufeinandertreffen verschiedener Religionen und Kulturen, die auf durchaus unterschiedlichen Werten und religiösen Regeln beruhen.
Den verbindlichen Rahmen setzen die allgemein geltenden Gesetze unseres Staates, aber sie schreiben keine Lebensform vor. Im Gegenteil: Sie sichern die persönliche Entscheidungsfreiheit. „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ und „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ So steht es in unserem Grundgesetz.
Aber während ländliche Gemeinden auch heute noch häufig stark von einer dominierenden religiösen Tradition geprägt sind, bedeutet das Leben in der Stadt Vielfalt. Religiöse Normen werden hier relativiert. Sie sind nicht mehr allgemeinverbindlich. In den Städten treffen viele Glaubensrichtungen aufeinander. Atheisten und Agnostiker begegnen Christen, Juden, Muslimen, Buddhisten, auch Sektierern aller Art.
Hat trotzdem ein starker Glaube im städtischen Leben Platz? Wie kann er sich im tagtäglichen unmittelbaren Kontakt mit Andersgläubigen und Nichtgläubigen behaupten? Oftmals ist es ein sich mehr oder weniger tolerierendes Nebeneinander, mitunter aber ein sich akzeptierendes Miteinander.
Das Leben in der Stadt bedeutet für gläubige Menschen eine Herausforderung – aber auch eine Bereicherung. Denn Vielfalt entsteht durch Verschiedenheit, und Vielfalt ist das Gegenteil von Gleichmacherei. Es geht also nicht darum, seine Überzeugungen aufzugeben. Im Gegenteil: Erst im Austausch der verschiedenen Positionen im Dialog wird Vielfalt lebendig. Je klarer und deutlicher die verschiedenen Positionen sind, desto fruchtbarer kann der Dialog werden.
Den Anderen ernst nehmen, respektieren und akzeptieren, ohne die eigene Position aufzugeben. Diese Haltung führt zu der Vielfalt, die für uns alle so produktiv und kreativ ist, die unser Leben bereichert und ein glückliches Zusammenleben möglich macht. Sie hat nichts mit der jener Toleranz zu tun, die über Jahrhunderte hinweg eher eine notgedrungene, widerwillige Duldung war. Jürgen Habermas hat darauf hingewiesen: “Unserer Toleranz, die ihre Wurzeln im 16. und 17. Jahrhundert hat, liegt kein Respekt zugrunde, im Gegenteil. Wir haben die Religion des anderen gehasst, Katholiken und Calvinisten hatten keinen Funken Respekt vor den Anschauungen der anderen Seite.“.
Heute bedeutet Religionsfreiheit, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht länger in ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaft einkapseln und gegeneinander abschotten. Gläubige, Andersgläubige und Ungläubige müssen sich gegenseitig Überzeugungen und Lebensformen zugestehen, die sie für sich selbst ablehnen. Sie müssen sich gegenseitig als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anerkennen und ihre kulturelle und weltanschauliche Identität gegenseitig respektieren. Auf dieser Basis ist auch in Konflikten eine Verständigung miteinander auf gleicher Augenhöhe möglich. In einer inklusiven Bürgergesellschaft ergänzen sich staatsbürgerliche Gleichheit und kulturelle Differenz. Deshalb war und ist auch die Forderung nach einer allgemeinverbindlichen Leitkultur ein Irrweg. In unserem großstädtischen Alltag wird das ganz klar: Die verschiedenen Kulturen begegnen sich in der Stadt nicht im Verhältnis von Dominanz und Unterordnung, sondern auf Augenhöhe.
Heute findet auf vielen Ebenen ein lebhafter interreligiöser Dialog statt – zwischen Gemeinden, in Arbeitskreisen und Projekten. Dieser Dialog nützt allen Beteiligten. Er ermöglicht Lernprozesse und setzt kreative Weiterentwicklungen in Gang.
Als Bezirksbürgermeister bin ich mehr als andere gehalten, die Trennung von Kirche und Staat zu beachten und alle Religionen gleich zu behandeln. Mir ist das nicht nur Verpflichtung, sondern auch ein wichtiges persönliches Anliegen. Die Anerkennung aller religiösen Überzeugungen auf der Grundlage unserer Rechtsordnung, wie sie von unserem Grundgesetz garantiert wird, ist ein Schlüssel für das friedliche Zusammenleben.
Deshalb unterstütze und fördere ich in Charlottenburg-Wilmersdorf den Interreligiösen Dialog, an dem sich viele der im Bezirk vertretenen Religionsgemeinschaften beteiligen. Im Juni 2012 haben sie eine “Gemeinsame Erklärung” (zu finden auf unserer Website im Internet unter www.dialog.charlottenburg-wilmersdorf.de ) unterzeichnet, die Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung und eine gute Grundlage ist für die Gespräche, zu denen wir uns mindestens viermal jährlich treffen. Dabei geht es vorrangig nicht um Glaubensfragen, sondern um ein besseres gegenseitiges Kennenlernen und Unterstützung, um Probleme des täglichen Zusammenlebens, um gemeinsame Projekte und insbesondere den Abbau von Vorurteilen.
Das Bekenntnis der eigenen religiösen Identität ist also kein Hindernis für einen Dialog, sondern im Gegenteil die Voraussetzung dafür. In einer interkulturellen Gesellschaft wie der in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo Menschen aus 170 Nationen zusammen leben, spielt der Dialog eine entscheidende Rolle für ein friedliches Miteinander. Ein interreligiöser Dialog und eine interreligiöse Zusammenarbeit können helfen, religiösen Konflikten vorzubeugen. In unserer Gesprächsrunde sind wir uns einig, dass gewaltbereiter Fanatismus dem Wesen jeder Religion widerspricht und dass im Gegenteil Toleranz und Akzeptanz anderer Überzeugungen zu den Grundsätzen jeder Religion gehören.
Die Religionsgemeinschaften leisten viele wertvolle Beiträge für das Zusammenleben in der Stadt. Dies gilt in besonderer Weise für die evangelische, aber auch die katholische Kirche. Die Gläubigen stehen mit beiden Beinen auf der Erde und engagieren sich in vielen kirchlichen Einrichtungen in der Kinder- und Jugendarbeit, im sozialen Bereich, im Gesundheitswesen, in Bildungsprojekten, in der Kultur, der Gedenkarbeit wie zum Beispiel der Stolpersteine-Initiative, auf Bürgerplattformen – kurz: In allen Bereichen, die unser Leben ausmachen! Ohne diese engagierte Arbeit der Kirchen und ihrer Gläubigen – also von Ihnen, liebe Gemeinde – wäre unser Leben in der Stadt um vieles ärmer.
Aber wie steht es mit dem Himmel? Spielt er für die Menschen in der Stadt noch eine Rolle? Schauen wir noch hinauf zu den Sternen? Können wir sie überhaupt noch erkennen in der Stadt, in der es nie dunkel wird? Wird Transzendenz in den Städten zur Privatsache? Empfinden wir es oftmals nicht als ein wenig peinlich oder deplaziert, unseren Glauben öffentlich zu bekennen?
Am vergangenen Montag fand die Gebetswoche der Evangelischen Allianz mit Gemeinden aus unserem Bezirk den Weg in den Minna-Cauer-Saal des Rathauses Charlottenburg. Pfarrer Raschkowsky hatte angefragt und ich habe zugesagt. So wurde der Bezirksbürgermeister zu den Themenfeldern Soziales, Vielfalt und politisches Amt befragt, meine Antworten und Anliegen daraufhin in Gebetsrunden aufgenommen. Besonders gilt dies für die Situation der zu uns kommenden Flüchtlinge und die humanitäre, diakonisch-karitative Verpflichtung, ihnen mitmenschlich im Wege einer Willkommenskultur zu begegnen. Hier bei uns in der City West und andernorts! Dieser gemeinsame Abend war für mich als auf der kommunalen Ebene politischer Verantwortungsträger und zugleich als evangelischer Christ eine neue, ermutigende und stärkende Erfahrung. Da war nichts peinlich, nichts beschämend – im Gegenteil, eine Begegnung, die wir wiederholen sollten und die es in dieser Form auch andernorts geben sollte.
Religionssoziologen bezeichneten Berlin noch vor wenigen Jahren als „Welthauptstadt des Atheismus“. Heute gibt es hier mehr als 250 religiöse Gemeinschaften, und sie feiern Gottesdienste an den angesagtesten Orten der Stadt: Im Programm-Kino, im Coworking-Space, selbst im Szene-Nachtclub. Einige von ihnen haben solchen Zulauf, dass in kürzester Zeit Ableger in anderen Stadtteilen entstehen. Vorwiegend junge und gebildete Menschen aus der Nachbarschaft fühlen sich angesprochen.
Das meinen moderne Philosophen, wenn sie zugestehen müssen: Die postsäkulare Gesellschaft ist längst Realität. Aber was bedeutet das für Religion und Politik? Was bedeutet es für unsere Städte? Werden Himmel und Erde neu justiert? Werden religiöse Heilsversprechen bald an die Stelle politischer Kämpfe treten?
Werden mit der Religion auch autoritäre Strukturen in die Stadt zurückkehren? Oder wird Religion im Zuge ihrer Verstädterung irgendwann zum bloßen Lifestyle? Welche Bedeutung hat Religion in der Mitgestaltung des öffentlichen Lebens? Wie erfahren wir die Religionen auf den öffentlichen Plätzen und in den politischen Auseinandersetzungen?
Vor einigen Wochen hat das Paul-Gerhardt-Stift eine Tagung unter dem Titel veranstaltet: “Religion findet Stadt”, wobei “Stadt” mit “dt” geschrieben wurde. Dabei ging es genau um diese Fragen. Es gilt, den begonnenen Dialog fortzusetzen und gemeinsam Antworten zu finden.
Die Trennung von Politik und Kirche war ein schmerzhafter historischer Prozess, und sie ist zu einem wichtigen Bestandteil unserer modernen Gesellschaft geworden. Und doch gibt es enge selbstverständliche Verbindungen. In vielen ethischen Fragen sind die Kirchen gefragt. Der Staat, ja die Gesellschaft insgesamt tuen gut daran, ihre Einwände und Anregungen aufzunehmen. Ob es um gentechnische Experimente, um ethische Fragen eines menschenwürdigen Todes oder um Flüchtlingspolitik geht. Aber auch die Kirchen müssen wissen, dass ihre Stellungnahmen zwar eine mitunter durchaus wichtige Rolle spielen im politischen Entscheidungsprozess, dass sie aber nicht automatisch Gesetz werden können. Und im Zweifel müssen die Kirchen staatliche, zumal parlamentarisch legitimierte Entscheidungen auch dann akzeptieren, wenn sie nicht mit ihnen einverstanden sind. Wobei ich nur am Rande anmerken möchte, dass Kirche zum Glück auch nicht immer gleich Kirche ist, wie dies aktuell am Beispiel der aus meiner Sicht dringend notwendigen Berücksichtigung vielfältiger Lebensweisen im Schulunterricht deutlich wird. Es geht natürlich um Akzeptanz und nicht um Indoktrination – im Gegensatz zu den in Baden-Württemberg kirchenleitend Verantwortlichen bedarf dies in dieser Frage in und mit der großen Mehrzahl der evangelischen Landeskirchen glücklicherweise keiner kritischen Diskussion mehr.
Das Verhältnis von Kirche und Staat ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen, es ist keineswegs eine strikte Trennung, sondern ein Spannungsverhältnis, in dem beide Seiten immer wieder aufs Neue voneinander lernen und profitieren können. Die Kirche ist keineswegs nur für den Himmel zuständig. Glücklicherweise mischt sie auch auf der Erde kräftig mit – gerade auch in der Stadt, vielfältig engagiert in Berlin, hier bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf.
Mir gefällt an dem Thema “Stadt zwischen Himmel und Erde” vor allem das Wort “zwischen”. Vielleicht auch Ihnen? Denn darauf kommt es an: Auf die Verbindung und die Vermittlung zwischen Himmel und Erde, auf den Dialog, auf das Zwischenmenschliche, auf das Voneinanderlernen. Eine Stadt wie Berlin fordert uns da in besonderer Weise immer wieder aufs Neue heraus und bietet zugleich so wundervolle Möglichkeiten, um glücklich zu leben.
Die evangelische Wochenzeitung „die Kirche“ hat in der ersten Ausgabe dieses Jahres mit Blick auf die Jahreslosung aus Psalm 73,28 gefragt: „Was würde Sie glücklich machen im neuen Jahr?“. Unser ehemaliger Charlottenburger 88jähriger Superintendent Hans Storck – Viele unter uns erinnern sich noch gut an ihn, gerade hier in Luisen – hat geantwortet: „Mich würde glücklich machen, wenn:- ich ein weiteres Jahr im Kreise meiner Familie und Freunden altengerecht leben kann,
- ich über mich selbst lachen kann,
- wir in unserem Land gerecht und friedlich miteinander leben können,
- verhindert wird, dass Krieg entsteht,
- die Kirche mit ihren engagierten Mitgliedern, Pfarrern und Kirchenleitungen daran ihren Anteil hat,
- Sie und ich spüren, wir sind von Gott geliebt.
Wie die Jahreslosung sagt: „Gott nahe zu sein ist mein Glück“.“
Und ich füge abschließend hinzu:
Einander zwischen Erde und Himmel in dieser Stadt mitmenschlich in gegenseitigem Respekt und Wertschätzung zu begegnen…
Und die Liebe Gottes, die höher ist als all’ unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.